
Monitor - 6x03: Ansichtssache
0,28 MB / Zip-File
Auf den langen Sternenflügen konnte er immer am besten über die Probleme des Lebens nachdenken, so fand zumindest Matthew Price. Der Halbbetazoid befand sich mit seinem Shuttle auf dem Rückweg zu Starbase 67, wo die Monitor immer noch angedockt war und auf neuerliche Befehle wartete. Die meisten Crewmitglieder begrüßten diese Möglichkeit Urlaub zu nehmen und auch Matt hatte es sich ein paar Tage eine Auszeit gegönnt. Wobei man das, was er während dieser Tage erlebt hatte, wohl nicht als Urlaub bezeichnen konnte.
Immerhin hatte er zum ersten Mal seinen leiblichen Vater besucht. Zwar kannte er ihn schon seit einem guten Jahr, doch jetzt erst wusste er überhaupt, um welche Person es sich handelte und wie er lebte. Immer noch wogen die Eindrücke der Reise schwer auf dem Halbbetazoiden.
Arsani Parul war sein Vater.
Das Undenkbare, etwas, was man eigentlich nur aus schlechten Filmen und Büchern kannte, war tatsächlich eingetreten. Ein langes Jahr lang hatten sie miteinander zu tun gehabt und dennoch war Matt niemals die wahre Natur ihrer Beziehung aufgefallen. Wieso nur?
Ihre Beziehung würde Zeit brauchen sich zu entwickeln, dies hatte Parul kurz vor Price´ Abreise gesagt und er hatte recht. Sie konnten nicht innerhalb weniger Tage oder Wochen die Fehler rückgängig machen, die fast dreißig Jahre lang vorgekommen waren. Vater und Sohn mussten sich nun Schritt für Schritt neu kennen lernen und versuchen einen Zugang zueinander zu finden. Dabei fiel dem ersten Offizier schmerzlich auf wie sehr er doch auch sein eigenes Kind vermisste. Yasmin hatte er schon längere Zeit nicht mehr gesehen, was an dem nun unterkühlten Verhältnis zwischen ihm und Selina lag. Sie hatten sich im Zorn getrennt und seitdem nicht mehr miteinander gesprochen. Dieser Stand der Dinge war auf keinen Fall akzeptabel, soviel stand für den Halbbetazoiden fest. Wenn er etwas in den letzten Tagen gelernt hatte, dann den Wert einer Familie.
Die Abgeordneten des Romulanischen Imperiums fanden sich nach der kurzen Essenspause, die jedem gestattet war, nach und nach wieder in den prächtigen Hallen des wiederaufgebauten Senats ein. Langsam, aber stetig, füllten sich die Sitzreihen wieder, damit man dem nächsten Punkt auf der Tagesordnung lauschen konnte. Nun endlich war die Zeit für Tek´lor gekommen seinen Vorschlag zu unterbreiten. Bedächtig und langsam, fast schon majestätisch näherte er sich dem Podium und legte sich seine wenigen Notizen zurecht.
Kurz wartete er, bis der Lärm auf ein erträgliches Mindestniveau herabgesunken war, dann setzte er an:
„Verehrte Abgeordnete, liebe Kollegen!
Ich spreche heute zu euch, da ich meine eine Lösung für ein Problem gefunden zu haben, welches dieses ehrenwerte Haus schon länger beschäftigt. Es ist eine Frage, dessen Beantwortung auf den ersten Blick nicht sehr dringlich erscheint. Beim näheren Hinsehen erkennt man jedoch, dass damit auch unzweifelhaft das Ansehen unseres großen Sternenreiches verbunden ist. Seit Monaten nun ereilen uns die Nachrichten vom Planeten Talar, der ehemaligen Hauptwelt der Talarianischen Union, welche seit Kriegsende Teil unserer Imperiums ist. Obwohl der Krieg schon ein halbes Jahr vorbei ist herrscht auf Talar immer noch Chaos. Ein Guerilla-Krieg wird gegen unsere Truppen geführt; ein Kampf Mann gegen Mann. Zu Beginn wollten wir uns nicht eingestehen, dass so etwas möglich ist, doch immer wieder erreichen die Talarianer nennenswerte Siege. Das Terrain ist ihnen bekannt und die neue Untergrundtaktik passt viel besser zu ihrer unterlegenen Technik als der offene Kampf. Die Opfer dieses Krieges, der täglich durch Anschläge und Vergeltungsmaßnahmen durchgeführt wird, ist die leidende Zivilbevölkerung Talars. Millionen Talarianer sind durch unser Bombardement des Planeten mit Antimaterie-Waffen ums Leben gekommen; eine Tat, die wir aus heutiger Sicht kurzsichtig nennen können. Denn der massive Einsatz unserer Kernwaffen hat die Ökologie Talars völlig zerstört. Ein nuklearer Winter ist ausgebrochen, dessen dichte Wolkenschicht in der Stratosphäre kaum Sonnenstrahlen durchlässt. In Folge dessen können keine Pflanzen und Getreide gedeihen, auch die Arbeit gestaltet sich durch die dauerhafte Kälte mehr als schwierig. Viele öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Schulen wurden zerstört, Seuchen breiten sich aus und raffen nur noch mehr Zivilisten hin.
Viele von ihnen werden nun sagen: die Talarianer sind der Feind, sie haben es verdient.
Doch ich bitte sie alle noch einmal über die Konsequenzen nachzudenken. Unser Ansehen bei den außerirdischen Regierungen schwindet zusehends, denn wir sind nicht in der Lage ein Massensterben zu verhindern. Wir brauchen aber mehr denn je wieder den Anschluss an die interstellare Gemeinschaft!
Daher mein Vorschlag: trotz unserer strengen Blockade sollten wir es außerirdischen und interstellaren Hilfsorganisationen erlauben nach Talar zu kommen. Sie können Lebensmittel mitbringen, ärztliche Versorgung sicherstellen und Hilfsprojekte starten. Solange kein außerirdischer Soldat seinen Fuß auf diese besetzte Welt setzt und damit nicht unsere Position dort unterminiert, sehe ich darin keine Gefahr. Bitte überlegen sie gut, morgen wird eine Abstimmung stattfinden. Entscheiden sie richtig!“
Glücklich trat Tek´lor vom Rednerpult herunter und begab sich wieder zu seinem Platz. Ja, seine Rede hatte genau den richtigen Ton getroffen und die Probleme, sowie ihre Lösungen, angesprochen. Der Romulaner hatte keinen Zweifel, dass die morgige Abstimmung zu seinem Gunsten ausfallen würde.
Unmittelbar im Anschluss an das Ende der Rede wurde der Bildschirm schwarz und beendete so die Aufzeichnung der Senatssitzung. John Lewinski ließ für einige wenige Sekunden das eben gehörte auf ihn wirken und blickte dann zu der Person, die ihm in seinem Büro gegenübersaß: Dr. Elisabeth Frasier, Chefärztin des Raumschiffs Monitor. Traurig seufzte der Captain, denn er konnte sich ganz genau denken, was nun kommen würde.
Dennoch versuchte er an eine Überraschung zu glauben und fragte:
„Was genau wollen sie mir mit der Abspielung dieser Rede, die ich übrigens schon mehrfach in den Nachrichten gesehen habe, sagen?“
Die attraktive Ärztin, die in Sachen Privatleben ein schwieriges Jahr hinter sich hatte, suchte sich kurz ihre Worte zurecht und begann dann ihre Bitte zu formulieren:
„Basierend auf diesem Hilferuf der romulanischen Regierung haben verschiedene interstellare Organisationen mit der Planung von Hilfsmissionen begonnen, darunter der Galaktische Bund des Ärztekollegiums. In wenigen Tagen wird eine Expedition der Mediziner nach Talar beginnen, wo man bei der Mindestversorgung der zahlreichen Kranken und Verwundeten helfen will.“
„Und?“ fragte Captain Lewinski und fürchtete die Antwort.
„Sir, ich würde sie gerne offiziell um Sonderurlaub bitten, damit ich mich einem dieser Expeditionsteams anschließen kann. Ich möchte helfen.“
„Ihr Engagement in allen Ehren,“ entgegnete John und faltete die Hände vor sich auf dem Schreibtisch, „wenn es nach mir ginge, dann könnten sie jetzt gleich aufbrechen, aber ich glaube kaum, dass das Geheimdienstoberkommando ihnen dies gestatten wird.“
„Wieso nicht?“ fragte Frasier fast schon aggressiv, erkannte dann den unzweckmäßigen Gebrauch ihrer Stimme und entschuldigte sich.
„Sie sind keine Ärztin wie jede andere,“ erklärte der Kanadier ihr, „sie sind beim SFI und waren somit mehr als einmal bei einer geheimen Operation dabei, die sich auch einmal gegen die Romulaner gewendet hatte. Was ist, wenn die Romulaner oder Talarianer sie entführen und etwas mit ihnen anstellen? Sie könnten verhört, ja sogar gefoltert werden, um einer der beiden Gruppierungen Informationen zu geben.“
„Ich glaube sie überschätzen mich, Captain. Natürlich war ich an einigen Operationen beteiligt, doch bei den meisten habe ich nicht einmal die Planung mitgemacht, geschweige sie ausgeführt. In erster Linie bin ich doch hier, um die medizinische Grundversorgung des Schiffes sicherzustellen.“
Lewinski schüttelte den Kopf. Sie schien nicht verstehen zu wollen, worauf er hinauswollte und daher entschloss er sich dazu direktere Worte zu wählen:
„Doktor, ich mache mir einfach Sorgen um sie!“
Angesichts dieser Worte verharrte die Ärztin für einen kurzen Moment und dachte darüber nach, was das eben gesagte bedeutete. Sie waren schon lange gute Kollegen, aber waren sie inzwischen sogar befreundet? Inzwischen dienten sie alle schon so lange an Bord dieses Schiffes, das komplizierte Muster der Freundschaft entstanden waren, die in den meisten Fällen ein großartiges Arbeitsklima schufen.
„Ich danke ihnen für diese Worte, Captain,“ antwortete Elisabeth ehrlich, „und ich würde lügen, wenn ich sagte ich hätte keinerlei Angst. Doch ich bin Medizinern und in Folge dessen an den hippokratischen Eid gebunden. Ich möchte doch nur diesen armen Leuten helfen, die schon so große Not leiden. Den Untergang der Talarianischen Union haben wir nicht verhindern können. Vielleicht sind wir jedoch in der Lage ein klein wenig zu helfen.“
Der Kommandant blickte sie einige Sekunden lang an und überlegte, was das richtige sein würde. Dann schließlich wandte er sich ab und meinte:
„Ich werde ihren Antrag weiterleiten, kann ihnen aber nichts versprechen.“
„Das ist schon gut genug. Danke!“ sagte Dr. Frasier und erhob sich, um ihre Sachen zu packen. Egal, was das Oberkommando sagen würde, sie würde diese Mission antreten, soviel stand für sie fest!
Alles wirkte für ihn auf einmal so monoton und sinnlos. Gemeinsam mit Crewman Tinker befand sich der Sicherheitschef des Raumschiffs Monitor in der Waffenkammer des Schiffes und nahm eine Routineüberprüfung vor. Eigentlich sollte Danny diese Prozedur durchführen, doch die Arbeit hatte er an den jungen Matrosen abgegeben und nun saß er auf einer großen Frachtkiste herum, beobachtete Tinker bei der Arbeit. Eine Materialprüfung fand gerade statt, wie so oft, wenn die das Schiff mal an einer Raumstation angedockt war und sich die Gelegenheit bot diese Arbeiten durchzuführen. Ein Phasergewehr nach dem anderen holte der Crewman aus einem Wandschrank, nahm es kurz in Anschlag ( um die Visiereinstellung zu testen ), aktivierte einmal die Energiezelle ( um die Batterie zu prüfen ) und stellte das Gewehr wieder zurück.
„Nr. 374 821 überprüft und voll funktionsfähig,“ erklärte Tinker mechanisch, machte eine Notiz auf seinem Padd, auf dem eine Inventarliste abgespeichert war und wiederholte die Prozedur mit der nächsten Waffe. Danny konnte es kaum glauben, doch dem jungen Mann schien diese Arbeit wirklich Spaß zu machen. Er selbst jedoch fühlte sich schlapp und machte keinerlei Anstalten zu helfen. Viel mehr sinnierte er weiter über sein eigenes Schicksal.
Wie hatte es nur so weit kommen können? Wie hatte Danny Bird, der eigentlich so hervorragende Offizier, zu einem Verräter an der Föderation werden können? Wieder und wieder stellte er sich die selbe Frage, ohne jemals eine Antwort zu bekommen. Und wenn alles so für seine Schuld sprach, wieso hatte dann die kürzlich erst stattgefundene Befragung für ihn keine Konsequenzen? Commander Elena Kranick hatte ihn massivst in die Mangel genommen und jedes einzelne ihrer Argumente war wahr gewesen. Wieso war er also nicht schon längst vor ein Gericht gestellt worden? Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Captain da ein Wörtchen mitgeredet hatte. Vielleicht sollte er einfach so direkt sein und Commander Kranick fragen. Sie müsste wohl am ehesten in der Lage sein seine Fragen zu beantworten.
Irgendwann stellte Danny fest, dass er seit geraumer Zeit einen Phaser anstarrte, der in einer Waffenkiste direkt vor ihm lag. Unangenehme Gedanken kamen in ihm hoch, die dennoch unaufhaltsam waren. Wie einfach wäre es nun sich diese Waffe zu greifen, an die Schläfe zu halten und abzudrücken! Dann wären all die Zweifel vorbei, er müsste sich nicht mehr mit den Problemen dieser Welt herumschlagen. Vielleicht wäre es wirklich besser, wenn ihm der Tod die endgültige Erlösung bringen würde. Keine Zweifel mehr, keine Furcht, sondern nur noch Stille. Wie lange würde ein solcher Selbstmord dauern? Es konnte sich nur um zwei oder drei Sekunden handeln, einer Zeitspanne in der Crewman Tinker ihn niemals hätte aufhalten können. Einfach zugreifen und abdrücken, dann war es vorbei.
„Sir, ich bin mit den Gewehren fertig,“ riss ihn plötzlich sein Untergebener mit dieser Meldung aus den unheilvollen Gedanken. „Soll ich nun mit den Sprengsätzen fortfahren?“
Danny blinzelte und musterte ihn überrascht, brauchte einige Minuten, um wieder zu sich zu kommen. Dann nickte er, murmelte etwas unverständliches und zog sich in sein mentales Schneckenhaus zurück.
Bisher war er während seiner Flucht nicht weit gekommen. Nachdenklich saß der ehemalige Chief Jozarnay Woil in seinem privaten Shuttle und dachte über die Ereignisse der vergangenen Tage nach. Noch vor kurzem hatte er sich auf seiner Heimatwelt Antos befunden, bei seinen Eltern und nach einem Zerwürfnis mit eben jenen befand er sich nun auf einer Reise ohne Ziel. Zum ersten Mal in seinem Leben konnte der Antosianer dort hin gehen, wo er selbst hinwollte, denn keine beruflichen oder privaten Verpflichtungen konnten ihn an einen bestimmten Ort binden. Doch was tun mit der neu gewonnenen Freiheit?
Müde rieb sich Jozarnay über den Schädel und vermisste immer noch sein zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenes langes Haar, welches er erst vor kurzem abgeschnitten hatte.
Die alten Zöpfe müssen ab!, so lautete ein alter Kampfspruch von der Erde, wenn sich Woil richtig entsann. So richtig hatte er eigentlich nie verstanden, was er heißen sollte, doch seiner Meinung nach war er im Moment mehr als passend. So viele Jahre lang war sein Haupthaar ein Symbol seiner spirituellen Einstellung gewesen, sein Bekenntnis zum göttlichen Herrn.
Nun hatte er mit seiner alten Kraft gebrochen. Zu unsinnig schien es ihm an jemandem festzuhalten, der ihn ohnehin für seine Sünden strafen würde. Für Jozarnay war dies alles nur noch sinnlos. Jedoch schloss er nicht aus, dass diese temporäre spirituelle Krise vom Ketracel-White herrührte und vielleicht bald schon wieder vorbei sein würde. Um dies herauszufinden hatte er Kurs auf Jubalee gesetzt, dem einzigen Mond von Antos. Auf dem Jahrtausende alten Mond, der ungewöhnlicherweise die selben Charakteristika wie ein Planet der Klasse M aufwies, befand sich ein jahrhundertealtes Kloster mit antosianischen Mönchen. Es war das letzte Rückzugsgebiet für die Anhänger einer Religion, die im Aussterben begriffen war.
Dort hoffte der ehemalige Chefingenieur endlich Gewissheit zu finden, sei es nun positiver oder negativer Natur. Der Flug hatte nicht lange gedauert und das Shuttle setzte vor dem alten, aus Stein gehauenen Kloster auf. Auch wenn dieser ganze Ort primitiv anmutete,
so hatte man hier eigens eine Landerampe für Raumschiffe eingerichtet, auch wurde das ganze Areal von Waffensystemen geschützt. Die Mönche würden sich sehr wohl zu verteidigen wissen, wenn man sie jemals herausfordern würde. Doch in der langen Zeit, in der dieses Kloster existierte, war es kaum zu nennenswerten Zwischenfällen gekommen.
Zu gering war einfach das Interesse etwaiger Eroberer an diesem Ort der Kontemplation.
Jozarnay Woil verließ das Shuttle, schulterte seine Tasche und begab sich zum Haupttor, wo er, sehr zu seiner Überraschung, schon von einem jungen Mönch erwartet wurde. Der Mann war jünger als er, vielleicht Mitte zwanzig und trug wie alle Gottesdiener eine lange, grüne Robe. Sein Haar war unbedeckt und offen, was auf eine gegensätzliche Art animalisch wirkte. Ob diese Wildheit beabsichtig war? Immerhin galten die Mönche als sehr friedliebend.
„Willkommen in Gottes Haus,“ begrüßte ihn der Mönch freundlich und tippte sich mit der rechten Hand erst auf die Stirn, deutete dann mit dieser auf den Gast. Die althergebrachte religiöse Begrüßung.
„Haben sie mich etwa erwartet?“ fragte der ehemalige Chief und erwiderte die Geste, die ihm nicht mehr so einfach von der Hand ging wie noch vor einiger Zeit.
„Wir haben ihre Ankunft auf dem Radar mitbekommen. Wir mögen Mönche sein, aber wir sind nicht primitiv,“ erklärte der junge Ordensbruder höflich.
„Dies habe ich auch nicht angenommen.“
„Möglicherweise ist ihnen aber auch die Erklärung lieber, dass wir ihre Ankunft vorausgesehen haben,“ orakelte der Mönch.
„Wie meinen sie das?“ entgegnete Jozarnay irritiert.
Statt einer Antwort lächelte der Mönch nur wissend und bedeutete ihm ins Kloster zu folgen.
„Mein Name ist Tan,“ erklärte er, „ich werde sie bei ihrer Suche begleiten.“
„Woher wollen sie wissen, dass ich auf der Suche bin?“
Abermals lächelte der Mönch nur und brachte ihn zu seinem Quartier. Es versprach eine interessante Zeit zu werden!
Es war nur wenig Zeit vergangen seit ihrem ersten Besuch im Büro des Captains, was eigentlich ein gutes Zeichen war. Captain Lewinski hatte also tatsächlich Wort gehalten und den Antrag von Dr. Frasier so schnell wie möglich bearbeitet. Nicht, dass sie etwas anderes von ihrem Vorgesetzte erwartetet hätte. Zwanglos stand sie nun vor seinem Schreibtisch und wartete darauf den Grund zu erfahren, wieso sie ein zweites Mal zu ihm gebeten worden war.
„Ich habe ihren Antrag an das Oberkommando weitergeleitet,“ erklärte der Kanadier, „und auch meine ausdrückliche Empfehlung zur Billigung ihres Wunsches gegeben. Leider muss ich sie jedoch informieren, dass ihr Antrag abgelehnt wurde.“
„Abgelehnt?“ fragte die Ärztin irritiert und konnte in der Tat nicht glauben, was sie da eben gehört hatte. „Ich verstehe nicht so ganz wieso.“
Captain Lewinski erhob sich von seinem Sitzplatz, näherte sich der Ärztin und verschränkte seine Arme vor der Brust. Ihm war deutlich anzusehen, was er eigentlich von dieser Entscheidung der Oberen hielt.
„Das Geheimdienstoberkommando möchte nicht, dass aus dienstlichen Gründen ein Offizier der Sternenflotte nach Talar geschickt wird. Es könnte im Widerspruch zu unserem Prinzip der Nichteinmischung stehen.“
Überrascht wölbte Elisabeth Frasier die Augenbrauen, dann verfinsterte sich ihre Miene.
„Die Föderation hat sich verpflichtet humanitäre Hilfsaktionen zu begleiten und zu unterstützen. Von einer Einmischung in einen Konflikt, der beendet ist, kann gar nicht die Rede sein.“
„Er ist nur offiziell beendet,“ erinnerte der Captain sie.
Kurz kniff die Bordärztin die Augen zusammen und ordnete mehrere Gedankengänge. Für sie war glasklar, worum es hier wirklich ging. Sie war schon zu lange dabei, um sich von einer solchen Ausrede abspeisen zu lassen.
„Hand aufs Herz, Captain,“ forderte sie ihn mit sanfter Stimme auf, „worum geht es wirklich.“
Anerkennend musste John feststellen, dass er in der Tat durchschaut worden war. Daher gab es für ihn auch keinen Grund weiter diese Scharade zu spielen.
„Der wahre Grund, und den möchte das Oberkommando ihnen gegenüber nicht sagen, ist die Angst vor einer Entführung ihrerseits. Sie arbeiten für den SFI und besitzen Zugang zu geheimen Informationen, die man aus ihnen herausbekommen könnte.“
„Ich bin Ärztin,“ entgegnete Dr. Frasier kühl, „ich bin kein taktischer Offizier.“
„Und dennoch wissen sie über eine Vielzahl unserer Missionen Bescheid. Hören sie Doktor, ich stehe doch auf ihrer Seite, aber es geht einfach nicht.“
„Und nun?“ fragte sie resignierend. Sie hatte sich schon mit dem Abbruch dieser Idee geschlagen gegeben, da überraschte sie der Captain mit einer neuen Variante:
„Das Oberkommando gestattet ihnen keine dienstliche Mission auf Talar.“
„Das heißt?“ fragte Elisabeth.
„Wie wichtig ist ihnen diese Mission?“
Kurz dachte die hübsche Frau an die zahllosen Opfer auf dem Planeten, das Elend und die Gebrechen. Sie entsann sich des hippokratischen Eides, der sie zur Hilfe zwang.
„Sehr ernst. Ich möchte helfen!“ meinte sie schließlich mit fester Stimme.
„Wenn sie mir einen Urlaubsantrag einreichen,“ erklärte Lewinski, „so werde ich ihn unterzeichnen. Ich kann ihnen keine Befehle geben, wo sie ihren Urlaub verbringen möchten. Auf der Erde, Mars, Vulkan, Talar oder Betazed, es ist ihre Sache.“
In Frasiers Augen blitzte es, als sie sich dieser Variante bewusst wurde. Sie würde ihren Urlaub opfern müssen, doch dies war es ihr wert. Eine tolle Idee des Captains! Ihr wurde bewusst, was für ein Glück sie doch mit diesem Kommandanten hatte. Andere hätten diese Variante nicht zugelassen.
„Ich werde mich sofort ans Schreiben dieses Antrags machen,“ erklärte sie.
„Ach ja,“ fügte Captain Lewinski beiläufig hinzu, „bei der Materialprüfung fiel uns ein Überschuss an medizinischen Produkten auf, die wir im Lager haben. Bitte sorgen sie dafür, dass sie an dringend benötigtere Dienststellen verteilt werden.“
Wieder wurde der Doktor angenehm überrascht und zwinkerte dem Captain zu. Was für ein toller Kerl er doch war.
„Selbstverständlich,“ antwortete sie keck, „ich werde mich persönlich um die Umverteilung kümmern.“
„Ich habe auch nichts anderes erwartet,“ entgegnete Lewinski lächelnd und machte sich wieder an seine Schreibarbeiten.
Diese Wartungsarbeiten! Niemand machten sie Spaß, dennoch mussten sie erledigt werden, um kleine Fehler nicht zu übersehen, die zu einem späteren Zeitpunkt im schlimmsten Fall die Sicherheit des Schiffs gefährden könnten. Lieutenant Ardev, Andorianer und seines Zeichens Einsatzoffizier der Monitor, befand sich in der kleinen Holokammer des Schiffes und ging die Verzeichnislisten durch. Dieser kleine Raum war das wohl auffälligste Vermächtnis des ausgeschiedenen Chief Woils gewesen. Ein Hologitter in einen so kleinen Raum wie diesen zu integrieren hatte als so gut wie unmöglich gegolten. Dennoch war dem Antosianer dieses Kunststück gelungen und hatte so vielen Besatzungsmitgliedern eine Freude bereitet.
Derzeit war Ardev dabei die verschiedenen Programme durchzusehen und alte, nutzlose zu löschen, um neuen Rechenspeicher frei zu machen. Denn jede einzelne Holosimulation, ob sie taktischer oder rein privater Natur war, fraß jede Menge Rechenspeicher, der auch gut für andere Dinge genutzt werden konnte. Erst machte sich der Lieutenant an die dienstlichen Dateien, die hauptsächlich aus taktischen Manövern, Schießübungen und Sportprogrammen bestanden. Er löschte einige alte Simulationen, für die es längst neuere und leistungsfähige Simulationen gab, sowie einige Programme, die noch aus dem Dominion-Krieg stammten und bei der derzeitigen politischen Lage nicht mehr aktuell waren. Im Anschluss daran machte sich Ardev daran die privaten Dateien zu durchforsten. Dieser Bereich musste besonders sensibel behandelt werden, da viele Leute ihre privaten Ideen und Gedanken mittels eines Holodecks manifestierten und es ganz sicherlich nicht in ihrem Interesse war, dass diese bekannt wurden. Captain Lewinski hatte ihn zu Beginn der Arbeiten noch einmal darauf eingeschworen, dass ihn die Belange der anderen Besatzungsmitglieder nichts angingen und der Andorianer war gewillt sich daran zu halten. Er ging sogar mit gutem Vorbild voran und löschte einige Programme, die er selbst nicht mehr gebrauchte. Schon erstaunlich, was sich für altes Zeugs über die Monate ansammelte, den man anschließend vergaß.
Dann jedoch wurde seine sonst so vorbildliche Einstellung auf eine harte Probe gestellt.
Als nächstes erschien auf dem Bildschirm der Name seiner Frau Arena Tellom, was an sich schon eine Überraschung war. Denn seine terellianische Ehefrau gehörte zu den wenigen Personen an Bord, die nicht das Angebot des Holodecks nutzte. Ihr stand, wie sie selbst sagte, mehr der Sinn nach realen Dingen, wie einem guten Buch oder Gesprächen mit ihrem Mann. Dies bedeutete nicht, dass sie dem Holodeck feindlich gegenüberstand, denn sie nutzte es für dienstliche Zwecke, doch privat ließ es sie völlig kalt. Zumindest hatte sie dies immer wieder behauptet und so überraschte es den Lieutenant um so mehr ihren Namen in der Liste der Privatdateien zu finden. Auch war nur ein einziges Programm eingetragen, welches den nichts sagenden Titel Arena 1 trug, unter dem man sich wahrlich nichts vorstellen konnte.
Lange kämpfte Ardev mit seinem Gewissen. In der Tat handelte es sich um ein privates Programm, doch immerhin handelte es sich bei dem Offizier nicht um eine fremde Person, sondern seine Ehefrau. Gab ihm jedoch dies ihm das Recht das Programm zu öffnen? Immerhin besaß sie auch als seine Frau noch ein Recht auf Privatsphäre. Ardev kam sich vor wie eine Figur in einem alten terranischen Comic, auf dessen einer Schulter ein kleiner Engel, auf der anderen ein kleiner Teufel saß und beide wollten ihn lenken eine bestimmte Tat zu tun. Schließlich jedoch musste der Andorianer seiner Neugier Tribut zollen und aktivierte das Programm. Er hatte erwartet, dass sich der gesamte Raum veränderte, doch stattdessen erschien nur eine Person aus dem Nichts, der sich als Andorianer entpuppte. Er war etwas größer als Ardev, deutlich älter und trug dennoch würdevolle Kleidung, die ihn als Politiker auswies. Unmittelbar im Anschluss an diese Materialisierung weiteten sich Ardevs Augen, als ihm bewusst wurde, wen er vor sich sah.
„Guten Tag,“ begrüßte ihn das Hologramm, nachdem es kurz einen Zugriff auf die interne Uhr des Schiffes genommen hatte und sich so sicher war, dass sie sich nicht mitten in der Nacht befand.
„Bolar!“ rief Ardev entsetzt aus, der die Figur vor sich nun erkannt hatte. Wie hatte er dieses Gesicht nur vergessen können? Der Mörder an unschuldigen Terellianern, der Grund für die Verfolgung zahlreicher Andorianer! Was machte er hier, in einem Programm seiner Frau?
Für einen kurzen, irrationalen Moment fragte sich Ardev, ob dieses Monster es aus dem Jenseits geschafft haben mochte seine Frau heimzusuchen, doch dann entsann er sich einer sinnvolleren Erklärung.
„Ah, wie ich sehe erkennen sie mich,“ entgegnete Bolar höflich und faltete seine Hände hinter dem Rücken, was erschreckend harmlos wirkte.
„Was machen sie hier?“ fragte Ardev wütend.
„Ich bin das letzte Überbleibsel Bolars, eines Mannes, der sich sehr wohl seines Schicksals bewusst war. Man könnte in der Tat sagen ich bin sein Nachruf. Ein vor seinem Tode aufgezeichnetes Programm, welches an die Person ausgehändigt werden sollte, die ihn schließlich getötet hatte.“
Die Worte klingelten in den Ohren des Andorianers. Ja, Arena hatte ihm vor kurzem gestanden, dass sie es gewesen war, die Bolar getötet hatte. Nachdem ihr von einer unbekannten Quelle mitgeteilt worden war, dass der Mörder ihres Bruders noch lebte hatte sie sich zu der geheimen Internierungsstation begeben und ihn nach einem heftigen Wortgefecht erschossen. Ardev war schockiert über diese Tat gewesen, doch schließlich hatte er ihr verziehen. Ursprünglich hatte er beschlossen dieses Kapitel zu vergessen, doch nun wurde es ihm abermals schmerzlich in Erinnerung gerufen.
„Ich werde das Programm löschen!“ raunte der Lieutenant und begab sich zu der Konsole.
„Nein, warten sie!“ rief die Projektion Bolars und wirkte auf einmal sehr verschüchtert.
„Wieso sollte ich warten?“
„Haben sie aber kein Interesse an... einem Gespräch?“
Mit hasserfülltem Gesichtsausdruck blickte er den Angehörigen seines Volkes an und schüttelte den Kopf.
„Ich wüsste nicht, worüber wir beide uns unterhalten könnten.“
„Wie wäre es mit der Zukunft unserer Spezies?“
Und obwohl er dies nicht wollte ließ er von der Löschen-Taste der Konsole ab.
Aus irgendeinem Grund gewährte dieser Einsatzoffizier dem Programm noch eine Gnadenfrist. Wieso, dies wusste er selbst noch nicht.
Lange hatte er darüber nachgedacht, ob er es tun sollte. Schließlich entschied sich Danny Bird dafür die Sache durchzuziehen. Es dauerte einige Zeit, bis das Komterminal eine Verbindung zu der Person hergestellt hatte, mit der er sprechen wollte. Ein Indiz dafür, wie beschäftigt die Frau wohl sein musste. Endlich, nach einer schier endlosen Zeit, die in Wirklichkeit nur eine Minute war, erschien das Gesicht vom Commander Elena Kranick auf dem Bildschirm.
Der Sonderermittlerin des Sternenflottengeheimdienstes war deutlich die Überraschung im Gesicht anzusehen, als ihr bewusst wurde, wer mit ihr sprechen wollte.
„Lieutenant Bird! Also mit ihnen habe ich nun gar nicht gerechnet,“ gab die Frau auch unumwunden zu.
Der Sicherheitsoffizier des Raumschiffs Monitor blickte sie nur aus müden Augen und fragte direkt:
„Wieso haben sie mich nicht verurteilt?“
„Wie bitte?“ entgegnete der Commander verblüfft.
„Sie haben mich freigesprochen und das obwohl sie mich zu Beginn der Vernehmung festgenagelt haben,“ erklärte Danny ihr. „Also will ich wissen, wieso ich mit keinerlei Konsequenzen rechnen muss.“
„Meine Gründe für die Entscheidung sind in meiner Dissertation niedergeschrieben worden... die allerdings für sie geheim ist,“ erklärte Commander Kranick ihm.
Doch dies reichte Danny nicht. Er verstand nicht, wieso man ihm nicht die Wahrheit sagen wollte. Viel mehr noch, er begriff nicht, wieso er nicht schuldig war.
„Ich will es aber wissen!“ raunte er.
Einige Momente lang überlegte Elena, legte sich ihre Worte zurecht, bevor sie orakelte:
„Sagen wir es mal so: mir wurde meine eigene Rolle bei dem Verfahren bewusst.“
„Was soll das heißen?“
Wieder zögerte die Ermittlerin. Wie viel von ihrem eigenen Leben wollte sie nun in diesem Gespräch preis geben? Immerhin handelte es sich um Privatangelegenheiten, die besser nicht veröffentlicht werden sollten. Schließlich entschied sie sich doch dafür offen zu sein. Ihrer Meinung hatte Bird die Wahrheit verdient.
„Ich hätte sie fast aufgrund meiner eigenen Erfahrungen zu Verrat verurteilt,“ erklärte sie.
„Und dieser Geistesblitz ist dann wie aus dem Nichts erschienen, was? Nein, lassen sie mich raten: Captain Lewinski hat wieder eine seiner berühmten Reden geschwungen und sie damit überzeugt!“ polterte Bird, der sich mehr als paradox benahm. Scheinbar schien er wirklich daran interessiert zu sein sich selbst zu belasten.
„Nein, ihr Captain hat mich nur ermahnt! Er hatte recht, ich durfte sie nicht vorverurteilen.
Sie sind unschuldig!“
„Ich bin ein Verräter!“ fand Bird und schüttelte irritiert den Kopf. Wieso sahen sie alle dies nicht ein? „Ich wurde als Spion vom Dominion eingesetzt, nachdem ich übergelaufen war.
Ich habe ihnen all dies gesagt, es steht in den Akten! Wie kommen sie dann nur darauf zu behaupten, dass ich nicht schuldig bin.“
Langsam begriff die Ermittlerin, was der Mann von ihr wollte. Dieser ganze Anruf, dieses Gespräch beruhte auf einem Paradoxon.
„Sie wollen ihr Gewissen beruhigen,“ fand Kranick. „Sie haben so hohe moralische Ansprüche an sich selbst, dass sie sich selbst verurteilen möchten. In ihren eigenen Augen sind sie schuldig, obwohl sie die betreffende Tat nicht begangenen haben. Es war ein anderer Bird, der übergelaufen sind. Sie sind eine gänzlich andere Persönlichkeit, Lieutenant, sie müssen dies begreifen!“
„Ich bin Danny Bird!“ schrie der Lieutenant traurig.
„Ja, dies sind sie, aber ein anderer als zuvor! Sie sind ein guter Offizier und wertvoller Freund. Bitte geben sie sich nicht die Schuld für die Tat eines anderen! Ich würde gerne noch weiter mit ihnen über dieses Problem reden, doch ich muss schleunigst in eine Sitzung.
Jedoch hoffe ich, dass sie zu ihrem Frieden gelangen.“
Damit beendete Commander Kranick die Verbindung und ließ Danny Bird enttäuscht zurück.
In seinen Augen schien die gesamte Welt verrückt zu spielen. Wieso sah niemand ein, dass er schuldig war?
Die Unterkunft war irgendwie nicht ganz so komfortabel, wie Jozarnay sie erwartet hatte. Andererseits: was hatte der Antosianer überhaupt hier erwartet? Über das Kloster wurde nur wenig in der antosianischen Gesellschaft gesprochen, es wurde kaum wahrgenommen. Dennoch hatte er seinen Weg hierher gefunden, um einen letzte Anlauf zu starten zurück zu Gott zu finden. Während der ehemalige Chefingenieur seine Reisetasche auf das karge Bett warf dachte er darüber nach, wie sein spirituelles Leben früher gewesen war. Die Gebete hatte er verrichtet, die Gebote eingehalten. Sein Leben war nach einer übersinnlichen Richtschnur verlaufen, an der er nie einen Zweifel gehabt hatte. Bis er auf Humana abgestürzt war und trotz zahlreicher Stoßgebete grausam gefoltert worden war. Wo war der Gott in diesem Moment gewesen, an den er sich immer gerichtet hatte? Wieso hatte er ihn im Stich gelassen und diesen unerträglichem Schmerzen ausgesetzt? Mit einem kalten Schauer erinnerte sich Jozarnay daran, wie er fast auf diesem elenden Planeten, dessen Bewohner sich letztendlich gegenseitig vernichtet haben, gestorben wäre. Und dann war er wieder ans Ketracel-White geraten. Ein Jahr des Entzuges waren vollkommen umsonst gewesen. Seine Gier nach dem synthetischen Stoff war nur noch größer gewesen als vor seiner ersten Phase.
Langsam drehte sich der Antosianer herum und bemerkte, dass der ihn begleitende Mönch immer noch im Raum stand. Mit einem fast schon an einen Hund erinnernden treuen Blick beobachtete Tan ihn und schien die Andeutung eines feinen Lächelns auf seinen Lippen zu besitzen.
„Was ist?“ fragte Jozarnay überrascht.
„Ich denke darüber nach, was ihnen im Moment durch den Kopf geht,“ erklärte Tan ihm mit ruhiger, melodischer Stimme. „Dies hier ist die erste Phase ihrer Suche und sie gestaltet sich nicht so, wie sie es sich vielleicht vorgestellt haben.“
"Na ja," meinte der ehemalige Chefingenieur, "die ganze Einrichtung ist etwas karg."
Wie um seine Worte zu unterstreichen deutete er mit den Händen auf den leeren, unverputzten Raum, der nur durch ein Metallbett möbliert war. Ansonsten befand sich hier gar nichts.
"Ich nahm bisher immer an, dass in der antosianischen Religion Askese nicht gewünscht ist," fügte er eiligst hinzu.
"Oh, wir leben hier nicht asketisch," erklärte Tan und hatte wieder diesen seltsam melodischen Klang in der Stimme. "Wenn sie möchten, so können sie sich so viele Unterhaltungs- und Informationsgeräte holen wie sie benötigen; es ist ihnen nicht verboten. Nur wir benötigen diese Dinge nicht auf unserer Suche. Jedoch legen wir großen Wert darauf zu betonen, dass wir nicht primitiv sind. Intensiv beschäftigen wir uns mit anderen Anschauungen, beschäftigen uns mit klassischer und moderner Literatur und diskutieren darüber in Lerngruppen. Jedem ist es selbst überlassen, wie er seine Suche gestaltet."
"Sie meinen die Suche nach Gott?" stellte Jozarnay schließlich die Frage, die ihm am brennendsten auf der Zunge lag.
"Ist es das, was sie wollen?"
"Ja... das denke ich zumindest," gestand der ehemalige Sternenflottler. "Früher hatte ich auch einmal so langes Haar wie sie. Doch wie sie nun sehen, Tan, habe ich es abgeschnitten."
"Sie haben sich von Gott abgewendet?"
"Ich weiß nicht einmal mehr, ob Gott noch existiert."
Tan nickte, so als würde er diese Erklärung Tag für Tag hören und faltete seine Hände unter der Robe.
"Wir werden uns bald gemeinsam auf die Suche machen," erklärte er und wandte sich in Richtung der alten Holztür, "aber erst einmal sollten sie sich einleben. Ich werde sie morgen holen. Dann, wenn ihre Suche beginnt."
Damit verschwand er mit dem knarrenden Geräusch der alten Holztür, welche mindestens ebenso alt wie das Kloster selbst zu sein schien. Jozarnay begann damit seine Tasche auszupacken, nur um festzustellen, wie sinnlos doch dieses Unterfangen war, denn es existierte kein Schrank, in den man hätte etwas einräumen können. Also legte er seine wenigen Klamotten wieder zurück in die Reisetasche und setzte sich auf das Bett. Nach wenigen Minuten war er eingeschlafen.
"Das Problem, mein lieber Lieutenant, ist die Degenration unserer Gesellschaft!"
Einem Professor gleichkommend durchwanderte die Projektion Bolars das kleine Holodeck und dozierte über sein Thema. Ardev, Einsatzoffizier des Schiffes, konnte nicht anders und dem Toten zuhören. Erst vor kurzem hatte er diese Projektion des toten Bolars in den Datenbanken des Raumschiffes gefunden und schon schienen die alten Probleme wieder von vorne zu beginnen. Eigentlich war es sein festes Bestreben gewesen dieses Programm, welches sich in den Daten seiner Ehefrau versteckt hatte, zu löschen, doch aus irgendeinem ihm nicht ersichtlichen Grund hatte er dies noch nicht getan. Handelte es sich bei seiner Tat um eine Art Gnadenfrist? Einem letzten Versuch Bolar die Möglichkeit zu geben sein Verhalten zu bereuen? Sicher, die echte Person war tot, getötet durch die Hand von Arena, doch vielleicht konnte sein digitales Ich zur Reue gelangen.
Doch diese Hoffnung schien sich leider nicht zu erfüllen. Stattdessen begann das Programm, welches auf den digitalen Erinnerungen und Gedanken von Bolar basierte, mit ihm eine Diskussion über ihr gemeinsames Volk. Der Weg, den Ardev gerade beschritt, war gefährlich, dies wusste er. Er kannte Bolar erst wenige Stunden, doch schon bemerkte er die Faszination, die von dieser Person ausging. Zu Lebzeiten war dieser Mann ein charismatischer Politiker gewesen und diese Ausstrahlung hatte es ihm auch später ermöglicht Kämpfer für den Untergrund zu rekrutieren. Seine Worte fesselten ihn, nicht so sehr in der Hinsicht, weil er ihnen zustimmte, sondern weil sich aus ihnen eine konstruktive Diskussion herausbildete.
"Ich fürchte ich kann ihnen in diesem Punkt nicht zustimmen," widersprach ihm Lieutenant Ardev.
"Ach nein?" entgegnete die Holoprojektion Bolars und wirkte überrascht. Hätte sein reales Selbst ebenso reagiert oder ein anderes Verhaltensmuster an den Tag gelegt? Unglücklicherweise würden sie wohl niemals eine Antwort auf diese Frage erhalten.
"Ihre Aussage unser Volk sei degeneriert, entbehrt jeder Grundlage."
"Aber wir sind vom alten Weg abgekommen!" unterbrach ihn Bolar.
"Ja, dies mag stimmen, doch dies muss nicht unbedingt schlecht sein. Wir haben den Weg des Kampfes verlassen, eine Verhaltensweise, die wir Jahrhunderte pflegten und uns Respekt einbrachte. Nun erlangen wir diesen Respekt auf andere Art und Weise: wir verhandeln mit den anderen Föderationsmitgliedern. Wir erwerben uns Respekt durch selbstsicheres und uneigennütziges Auftreten. Zwei Dinge, die sie selbst als Tugenden Andors beschrieben."
"Dies ist aber kaum zu vergleichen!" fand Bolar trotzig.
"Warum?" fragte Ardev und ihm war deutlich sein Unverständnis anzusehen. "Nur weil wir kein Blut vergießen sind wir doch nicht schwach geworden!"
"Oh, da sieht man ihre mangelhafte Erfahrung in Sachen andorianischer Geschichte, mein junger Freund," meinte Bolar und wechselte abermals in den lehrerhaften Ton. "Ich lehne doch nicht den Weg der Verhandlung ab, weil ich ihn als schlecht empfinde! Halten sie mich etwa für so beschränkt in meinem Weltbild? Nein, für Menschen oder Vulkanier ist dies ein absolut ehrbarer Weg zu Respekt zu gelangen, doch unsere Art ist dies nicht! Wir sind Andorianer! Wir sind ein Volk von Kriegern und als solches müssen wir unseren Weg mit Aggressivität beschreiten, mit Stärke und Mut. Früher einmal, als es noch das Andorianische Imperium gegeben hatte, waren wir Herr dieser Fähigkeiten, doch durch den Beitritt zur Föderation haben wir unsere natürlichen Eigenschaften vernachlässigt."
"Und durch einen Angriff auf terellianische Zivilisten glaubten sie diese Stärken wieder deutlich machen zu können?"
Ardevs stichelnde Frage war provokant und mehr als unklug. Immerhin befand er sich mit einem bekannten Mörder in einem Raum und, ob Projektion oder nicht, er konnte gefährlich werden. Doch immer noch schien Bolar die Ruhe in Person zu sein, hatte scheinbar nichts anderes im Sinn als eine lebhafte Diskussion.
"Was würde sie sagen, wenn ich ihnen eröffne, dass jeder einzelne terellianische Zivilist, den ich getötet habe, mir leid tut?" fragte er mit Grabesstimme.
"Ich würde ihnen wahrscheinlich nicht glauben," gestand der Lieutenant offen und ehrlich.
"Aber es entspricht der Wahrheit. Sehen sie mich an: ich bin ein Familienvater, habe Frau und Kinder. Meine Datenerinnerungen reichen leider nur bis zum Punkt der Abreise meines realen Selbst nach Terellia, also kann ich nicht sagen, wie sich Bolar während des Angriffs fühlte. Doch ich kann ihnen sagen, wie er kurz vor Aufbruch zu der Mission empfand."
"Wie?"
"Er hatte Angst," gab die Holoprojektion zu. "Und er schämte sich. Ja, sie mögen es kaum glauben, doch er schämte sich für seinen Plan. Ich habe immer die Terellianer dafür angeprangert, wie sie die Geschichte verfälscht haben. Wie sie behaupteten nur wir wären die erbarmungslosen Aggressoren gewesen, die vor allem die Zivilbevölkerung abgeschlachtet hatten. Doch auch die terellianische Armee war leider berühmt für ihren Einsatz von Waffen in belebten Stadtgebieten. Ich wollte das andorianische Volk wieder zurück auf den alten Weg bringen, Lieutenant Ardev, dies beinhaltete ebenfalls den Weg der Ehre. Auch wenn Befehlshaber in unserer Vergangenheit mehr als einmal missachtet haben, so ist die wissentliche Tötung von Zivilisten, von Frauen und Kindern, niemals unser Stil gewesen. Es sollte niemals der Stil von irgendeiner Nation sein."
Der Andorianer war in der Tat sprachlos. Dies, was er gerade gehört hatte, konnte er beim besten Willen nicht glauben. Bisher war es immer am einfachsten gewesen sich Bolar als den Schlächter von Terellia vorzustellen, als gewissenlosen Mörder und Verbrecher. Nun wollte ihm dieses Hologramm sagen, dass Bolar bedauerte. Konnte dies alles nur eine Lüge sein? Sagte er dies nur in dem Bewusstsein tot zu sein?
"Jede einzelne Zivilperson, die starb," fuhr Bolar fort und sah ins Leere, "war eine zuviel. Dies ist meine aufrichtige Meinung. Ich fürchte nur die Nachwelt wird dies nie erfahren."
Überwältigt von den Gefühlen, die ihn nun überkamen, deaktivierte Ardev das Programm. Wortlos, ohne ihm etwas davon zu sagen, ließ er Lieutenant die Projektion verschwinden und befand sich wieder allein in der kleinen Holokammer. Er brauchte Zeit zum Nachdenken. Sehr viel Zeit.
Die Reise war lang und beschwerlich gewesen. Gerne würde Elisabeth Frasier davon sprechen endlich angekommen zu sein, doch eine innere Stimme warnte sie, dass alles wohl nur noch schlimmer werden würde. Die letzten Stunden hatte sie in mehreren privaten Raumtransportern verbracht, die sie über Umwege nach Talar gebracht hatten. Noch immer gab es keine direkte Verbindung zwischen der von den Romulanern besetzten Welt und der Föderation, also hatte die Chefärztin etwas tricksen müssen, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Über mehrere Randwelten und Außenposten waren die zumeist unbequemen Passagen gegangen, jeweils auf Frachtschiffen verschiedenster Bauweisen, die nicht für den Transport von Passagieren ausgelegt waren. Die Reise hatte einiges an Geld gekostet, denn die meisten Frachterkommandanten flogen dieses Krisengebiet nicht gerne an. Elisabeth zählte ihre Finanzen durch und stellte zufrieden fest, dass sie immer noch genug für den Rücktransport besaß.
Zum Glück hatte niemand von ihr verlangt ihre privat Fracht zu versetzen, die zum großen Teil aus den Medikamenten bestand, die sie mit Erlaubnis von Captain Lewinski hatte mitnehmen dürfen. Es war nicht viel gewesen, doch anhand der wenigen Berichte, die von Talar an die Öffentlichkeit gelangten, wusste sie, dass jedwede Art von Hilfe willkommen war. Auf dem letzten Abschnitt ihrer Reise hatte Elisabeth schließlich eine Mitstreiterin kennen gelernt. Es handelte sich um eine denobulanische Ärztin namens Ixa, die aus dem selben Grund wie sie nach Talar unterwegs war: um sich en Ärzteteams anzuschließen. So hatte sich der Bordärztin auch die Möglichkeit geboten die neuesten Entwicklungen auf dem medizinischen Markt mit einer Kollegen zu diskutieren, was den Flug weniger langweilig gemacht hatte als zunächst noch befürchtet.
Schließlich war es soweit: der kleine Frachter setzte zu seinem Landeanflug in die Atmosphäre von Talar an. Dr. Frasier und Dr. Ixa drückten sich gegen die kleinen Bullaugen, um sich ein Bild der Situation zu machen. Schon der Anblick aus dem Weltraum war überwältigend. Hunderte von romulanischen Kriegsschiffen umkreisten den Planeten, kontrollierten ein und ausfliegende Schiffe. Raumstationen wurden errichtet, die die dauerhafte Besatzung des Planeten gewährleisten sollten. Doch dies war alles kein Vergleich zu den Eindrücken, die sich ihnen beiden nach Einflug in die Atmosphäre des Planeten bot. Von alten Aufnahmen aus der Sternenflottendatenbank wusste sie, dass Talar eine klassische Welt der Gruppe M gewesen war, der Erde gar nicht mal so unähnlich. Es hatte prächtige Ozeane und Kontinente gegeben, Millionenstädte und Landwirtschaft.
Dies alles war jedoch Geschichte. Durch das orbitale Bombardement der Romulaner hatte sich die talarianische Heimatwelt in eine atomare Einöde verwandelt. Die Ozeane waren zu einem großen Teil durch die entstandene Hitze verdampft worden, die großen Städte waren verwüstet und glichen Ruinenlandschaften. Funktionierende Infrastrukturen existierten kaum noch, die meisten Verkehrswege waren unbrauchbar. Doch das schlimmste war der durch den aufgewirbelten Staub verursachte nukleare Winter. Für viele Jahre würden kaum Sonnenstrahlen durch die Wolkenschicht durchdringen können und so Pflanzen das Wachsen ermöglichen. Auf dem ganzen Planeten war eine Kälteperiode ausgebrochen, die die gesamte Situation nur noch verschlimmerte. Und der beißende Wind, der durch die Ruinen wehte, schien niemals abzuflauen. Von den Talarianern wurde er schon traurig der Hauch des Todes genannt.
Durch die verwüstete Umwelt gestaltete sich auch der Landeanflug schwieriger als erwartet. Der Transporter schüttelte sich in unerwarteten Turbolenzen und der Pilot hatte alle Hände voll zu tun, um seine Fracht sicher auf den Boden zu bringen. Schließlich gelang es ihm jedoch und die beiden Ärztinnen packten ihr Hab und Gut, machten sich auf dem Weg zur Einreisehalle. Hierbei handelte es sich um einen gewaltigen Bau, in dem sich alle einreisenden Personen registrieren mussten, wenn sie Talar betreten wollten. An dieser Prozedur gab es kein Vorbei, wer versuchte sie zu umgehen, wurde ohne Umschweife erschossen. An den Einreiseschaltern saßen nur romulanische Beamte, denn Talarianern wurde nicht vertraut. Man fürchtete sie würden Söldner und Widerstandskämpfer durchlassen, die den romulanischen Besatzungstruppen arge Probleme bereiten könnten. Das Gedränge in der Halle war furchtbar. Überall standen Außerirdische verschiedenster Rassen und forderten wild gestikulierend, dass man sie als nächstes abfertigte. Frasier und Ixa brauchten sich nur kurz umzusehen, um zu begreifen, dass sie hier noch eine lange Zeit verbringen würden.
Und dem war auch schließlich so. Über zwei Stunden lang saßen sie auf dem kalten Boden der Abfertigungshalle und sahen zu, wie nach und nach die Besucher durchgeschleust wurden. Dann endlich, kurz vor Abend, waren sie an der Reihe. Beide Ärztinnen traten an das Pult, wo sie ein Romulaner mittleren Alters erwartete. Erst nahm er die Personalien von Dr. Ixa auf, die er peinlich genau in den Computer eingab, dann wandte er seine gesamte Aufmerksamkeit Elisabeth zu.
"Ihr Name?"
"Dr. Elisabeth Frasier," erklärte die Bordärztin in neutralem Tonfall. Trotz des langen Wartens wollte sie nicht durch Gereiztheit den Zorn der Romulaner auf sich ziehen.
"Staatsangehörigkeit?" fragte der Beamte routinemäßig und ohne von seinem Computer aufzusehen.
"Bürgerin der Vereinten Föderation der Planeten."
"Der Grund für den Aufenthalt auf Talar?"
"Ich möchte mich dem medizinischen Hilfsprogramm anschließen."
"Wie lange wollen sie auf Talar bleiben?"
"Ich habe mit einer Woche gerechnet, vielleicht auch zwei."
"Sind sie Angehörige der Sternenflotte?"
"Ja," gab Elisabeth offen und ehrlich zu. Sie fand nicht, dass es klug wäre die örtlichen Behörden anzulügen, denn dies würde nur Misstrauen verursachen. Eine Lüge wäre wohl eh sinnlos, da wahrscheinlich die Personalien von allen Einreisenden überprüft würden. Was würden sie wohl sagen, wen sie auf die nur mäßig vollständige Akte von ihr stießen?
"Welchen Rang bekleiden sie in der Sternenflotte?" fragte der Beamte und sah zum ersten Mal auf. Jetzt erst schien sein Interesse geweckt worden zu sein.
"Lieutenant-Commander."
"Was ist ihr Dienstposten?"
"Medizinische Fakultät der Sternenflotte, San Francisco, Erde." Dies war noch nicht einmal eine große Lüge. Offiziell war dies in ihrer Akte als ihr Dienstort eingetragen, da die Monitor ja nicht in den offiziellen Schiffsdatenbanken verzeichnet war.
"Führen sie irgendwelche Handfeuerwaffen mit sich?"
"Nein, dies tue ich nicht."
"Ich hoffe für sie, dass dies die Wahrheit ist," meinte der Beamte fast schon leidenschaftslos. "Ansonsten könnte dies als Einmischung ihrerseits angesehen werden. Ich weiß nicht, wer ihnen dies übler nehmen würde: wir oder die Terroristen. Wie auch immer, mehr Angehörige ihres Hilfsprogramms warten vor dem Raumhafen auf ihren Abtransport. Sie können sich der Gruppe anschließen."
Ihre Begrüßung auf dem Planeten war also alles andere als herzlich gewesen, doch ehrlich gesagt hatte niemand von ihnen ernsthaft mit Freundlichkeit gerechnet. Wer weiß, vielleicht gingen die Romulaner nicht einmal davon aus, dass sie alle noch lange zu leben hätten. Beide traten nun nach draußen, wo tatsächlich einige andere Ärzte warteten und wurden sich zum ersten Mal der niedrigen Temperaturen bewusst, die sie frösteln ließen. Hinzu kam noch ein böser Schneesturm, der die Sicht erheblich beschwerte.
Elisabeth fragte sich, wie lange sie wohl hier warten mussten, doch nur wenigen Minuten später traten mehrere bewaffnete Romulaner auf sie zu. Der Älteste von ihnen, der Anführer, rief mit starker Stimme gegen den starken Wind an und erklärte:
"Mein Name ist Commander Sokol. Ich werde dafür verantwortlich sein, dass sie sicher ihren Bestimmungsort erreichen, das Flüchtlingslager T-45. Dort werden sie ihr medizinisches Basislager aufschlagen und mit der Behandlung beginnen. Die romulanische Administration hier auf Talar gestattet es ihnen nicht die Umgebung des Lagers T-45 zu verlassen. Bedenken sie, diese Regeln sind nicht dazu da, um ihnen das Leben zu erleichtern, sondern um es zu retten. Wir haben auf so vielen Kanälen wie möglich dem talarianischen Widerstand mitgeteilt, dass wir heute Ärzte transportieren. Leider kann ich ihnen nicht garantieren, dass man darauf Rücksicht nehmen wird. Ich hoffe wir kommen heil im Lager an!"
Die Worte verursachten Beunruhigung in der Gruppe. Die meisten der Ärzte waren andere Bedingungen gewohnt, unter denen sie arbeiten konnten. Einige wenige von ihnen waren Veteranen vergangener Hilfsaktionen und hatten schon ähnliche Krisenherde erlebt. Nach und nach stiegen sie in den gepanzerten Truppentransporter, der sich altmodisch auf Rädern fortbewegen musste. Die Wetterbedingungen machten die Fortbewegung mit magnetischen Fahrzeugen zu riskant. Kurz nur dachte Frasier über Sokol nach, dann beschloss mit ihren neuen Kollegen ins Gespräch zu kommen. Der Truppentransporter wurde von drei Militärfahrzeugen der Romulaner eskortiert, wobei zwei der Wagen voraus fuhren und der dritte Rückendeckung gab. Das Tempo der Kolonne war äußerst niedrig, da die Sicht durch den Schneesturm erheblich eingeschränkt war.
"Du bist also bei der Sternenflotte?" fragte die Denobulanerin Ixa.
"Ja, dies bin ich," entgegnete Elisabeth ohne Umschweife.
"Bist du dienstlich hier?"
"Nein, ich bin offiziell im Urlaub. Man wollte mir keine Freistellung für diese Mission geben."
"Aha, ich verstehe. Hast du schon einmal so etwas mitgemacht?"
"Nein. Du denn?"
"Ja, es ist mein zweites Mal," erklärte Ixa und blickte kurz durch eines der Bullaugen, welches die verschneite Landschaft zeigte. "Ich habe schon einmal bei der Eindämmung einer planetenweiten Seuche auf Klestus 3 geholfen."
"Ich habe von diesem Zwischenfall gehört. Die Situation dort muss nicht allzu erfreulich gewesen sein."
"Nein, dies war es ganz sicherlich nicht. Aber ich fürchtete, gegen das, was uns hier noch bevorsteht, war das dort wie ein Ferienlager," meinte die Ärztin und blickte traurig ins Leere.
Sie beide schienen die einzigen an Bord zu sein, die Interesse an einer Unterhaltung zu haben schienen. Alle anderen Ärzte blickte nur betreten, teilweise ängstlich, zu Boden und wünschten sich nur, dass die Fahrt so schnell wie möglich vorbei gehen sollte. Elisabeth hoffte inständig, dass alles gut gehen würde. An den fachlichen Kompetenzen der meisten von ihnen bestand kein Zweifel, doch wie würden sie unter Druck reagieren? Immerhin würde Talar nicht die sauberen Bedingungen bieten, die sie alle gewohnt waren.
"Was machst du bei der Sternenflotte?"
"Ich bin in einer Ambulanz tätig."
"Auf der Erde?" fragte Ixa misstrauisch.
"Ja."
Angesichts dieser Worte lächelte die Denobulanerin nachsichtig.
"Ich kenne deine Spezies zu gut, Elisabeth. Inzwischen weiß ich, wann ihr lügt und wann nicht."
"Und?"
"Deine letzte Aussage war eine Lüge."
Kurz dachte Elisabeth Frasier über diese Worte nach, dann fragte sie:
"Wie sieht es damit aus, wenn ich sagte, ich könne nicht darüber reden?"
"Dies ist die Wahrheit und ich akzeptiere sie."
"Vielen Dank für dein Verständnis."
"Kein Problem," entgegnete die neugewonnene Freundin und zwinkerte ihr sogar zu. "Ich hoffe ich werde bald Zugang zu einem Kommunikationsterminal finden. Meinen Ehemännern möchte ich sagen, dass ich heil angekommen bin. Bist du verheiratet?"
"Nein."
"Dir scheint dieses Thema unangenehm zu sein. Dein Körper sendet gewisse Signale."
Die Bordärztin der Monitor war imponiert über das immense Wissen ihrer neuen Kollegin. Scheinbar hatte sie den richtigen Riecher für verschiedenste Spezies.
"Gibt es aber jemanden in deinem Leben?"
Dies war eine viel interessant Frage als Ixa wohl annahm. Elisabeth dachte einige Zeit darüber nach, wie sie antworten sollte.
"Ich...," begann sie und kam nicht mehr weiter, denn die Hölle brach um sie herum los.
Das erste Führungsfahrzeug der Kolonne explodierte in einem glühenden Feuerball und versperrte so den Weg der Straße, was den Rest der Gruppe zum Stillstand zwang. Commander Sokol, der sich im zweiten Fahrzeug befand, befahl mit lauter Stimme das Fahrzeug zu verlassen, denn ihn beschlich ein ungutes Gefühl. Er schnappte sich ein Disruptorgewehr und sprang aus dem Geländewagen hinaus in den Schnee. Keine Sekunde zu spät, denn auch das zweite Führungsfahrzeug explodierte. Zwei brennende Romulaner flüchteten aus den Trümmern und versuchten die Flammen im Schnee zu ersticken. Der romulanische Anführer hätte gerne seinen Soldaten geholfen, doch er war viel zu sehr damit beschäftigt die Lage zu analysieren.
Sie waren in einen Hinterhalt der Widerstandsgruppe geraten. Also hatte man ihren Aussagen man würde zivile Ärzte transportieren, keinen Glauben schenken. Oder aber ihre Nachricht war nicht an alle Gruppen durchgekommen. Inzwischen war das Netz der einzelnen Gruppen so weit verzweigt, dass nicht alle Leute unterrichtet werden konnte. Angespannt verdrängte Sokol diese Gedanken und versuchte die taktische Lage zu erfassen. Die beiden Fahrzeuge waren von einem Photonengranatwerfer zerstört worden, der gezielt eingesetzt worden war. Es musste sich um eine Gruppe von mehreren Talarianern handeln, die ihnen in dieser unwirtlichen Umgebung aufgelauert hatten. Die Schüsse kamen von vorne, also musste der Feind sich dort befinden. Wahrscheinlich versperrten ihnen die Trümmer der beiden Fahrzeuge die Sicht auf den Transporter und das dritte Militärfahrzeug, daher ließ ihr dritter Schuss auf sich warten.
Das hieß sie brachten sich in eine günstigere Feuerposition. Sokol sprang aus dem Schnee auf, in dem er bis eben noch gelegen hatte und rannte zu dem Transporter. Er riss die hintere Einstiegsluke auf und schrie:
"Bleiben sie hier im Wagen! Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Bleiben sie hier drinnen und es wird ihnen nichts passieren!"
Dann schleuderte er die massive Tür zu und warf sich unter das Fahrzeug, also unmittelbar danach zwei Phaserimpulse an ihm vorbeirasten. Das dritte Fahrzeug setzte sich nun in Bewegung, manövrierte sich intelligenterweise in die Sicherheit neben den Transporter und drei weitere romulanische Soldaten sprangen von dem Fahrzeug ab. Sie gaben mehrere ungezielte Deutschüsse in die ungefähre Richtung ab, aus der der Angriff erfolgt war und warfen sich dann zu ihrem Kommandanten.
"Die beiden Fahrzeugbesatzungen sind tot," flüsterte Sokol ihnen zu und versuchte in dem Schneegewühl etwas zu erkennen. Kurz setzte er die thermische Sichtbrille auf, doch durch die radioaktiven Interferenzen und dem Sturm brachte ihm dieses technische Gerät nichts. Nun galt es also Mann gegen Mann zu kämpfen. Unmittelbar im Anschluss hörten sie Schritte im Schnee, als der offenbar unerfahrene Angreifer auf den Transporter zu rannte und wild gestikulierte. Er schrie etwas auf talarianisch, was Sokol nicht verstand und langsam schälte sich seine Figur aus dem Sturm heraus. Sokol nutzte sofort den günstigen Augenblick und erschoss den Angreifer, der sich als junge Frau herausstellte. Sofort danach wechselten sie die Stellung und verschanzten sich wieder hinter einem der inzwischen ausgebrannten Fahrzeuge.
Kein Feuer ohne Bewegung, so lautete ein taktisches Sprichwort. Nun also schienen die Angreifer nahe genug gekommen zu sein, um sie zu erkennen, denn ein Gewitter aus Gewehrschüssen brach aus. Dies bedeutete, dass sie in Feuerreichweite des Transporters waren. Es war zwar nicht abzusehen, ob die Talarianer diesen angreifen würden, doch man konnte nichts ausschließen. Sokol feuerte noch drei weitere Schüsse auf schlecht erkennbare Schemen ab, dann packte er seinen Kommunikator und stellte eine Verbindung zu dem Militärfahrzeug her.
"Wir müssen die Talarianer von dem Transporter ablenken. Fahren sie aus der Deckung hervor und lenken sie so das Feuer auf sich, während wir den Feind von der Flanke angreifen!" befahl er dem Fahrer.
Seine Anweisungen wurden bestätigt und wild aus seinem Geschützturm feuernd bewegte sich das Fahrzeug nach vorne. Nun wurde die Unerfahrenheit der Talarianer deutlich, denn sie konzentrierten ihre kompletten Anstrengungen nun auf das schwere Gefährt und beschoss es mit ihren Handwaffen, die natürlich aufgrund der Panzerung wirkungslos blieben. Sie wollten eh nur Zeit herausschlagen, um ihre Panzerfaust in Betrieb zu nehmen. Dies war der Moment, auf den Sokol und seine Männer gewartet hatten. Sie verließen blitzschnell ihre Deckung und rannten auf die Talarianer zu. Sobald sie sie besser in Sicht hatten eröffneten sie das Feuer. Die Gruppe bestand aus sechs Leuten, vier von ihnen wurden sofort getroffen. Die anderen beiden schafften es noch den Angriff zu erwidern, schossen einen romulanischen Soldaten nieder, bevor auch sie den Tod fanden.
Außer Atem, den Körper voller Adrenalin, blickte Sokol auf das Schlachtfeld, was sich ihnen darbot. Die Straße musst geräumt werden, bevor der Transporter seinen Weg fortsetzen konnte und in dieser Zeit würden sie ein leichtes Ziel abgeben. Es hieß wachsam bleiben und hoffen, dass alles gut ging!
Die ganze Situation wirkte lähmend auf ihn. Ganz allein, verlassen, saß Lieutenant Bird in der Waffenkammer des Schiffes und starrte vor sich hin. Er hatte sich auf einer der aufgrund der Zählungen zahllos herumstehenden Kisten hingehockt und wartete. Worauf er wartete wusste er selbst nicht genau. Vielleicht die Absolution, die ihm niemand erteilen konnte? Eigentlich hatte er sich hierher verzogen, um sich etwas mit Arbeit abzulenken, doch schon nach wenigen Minuten war ihm klar geworden, dass er nichts machen konnte. Zu sehr belasteten ihn seine persönlichen Probleme. Egal was er auch anfasste, seinen Konzentrationsspanne war zu gering, um die Arbeit zu beenden. So saß er einfach nur hier alleine herum und grübelte über sein Schicksal. Irgendwann schreckte ihn der Ruf vom Kommunikationssystem hoch.
Danny blinzelte zweimal, fragte sich unwillkürlich, wie viel Zeit inzwischen vergangen war und betätigte seinen Kommunikator:
„Bird hier!“
„Sir, ich habe hier einen Anruf für sie,“ erklärte Fähnrich Bolder, der derzeit seinen Brückendienst versah.
Müde rieb sich der Sicherheitschef die Augen. Worum konnte es hierbei gehen?
„Wer möchte denn mit mir sprechen?“
„Dies kann ich leider nicht mit Bestimmtheit sagen, Lieutenant, es handelt sich um ein eine verschlüsselte Mitteilung des Justizministeriums.“
„Na gut,“ brummte Bird, „stellen sie es mir auf den Bildschirm in der Waffenkammer durch.“
Bolder tat wie ihm geheißen und der Bildschirm der Waffenkammer zeigte nicht mehr einige Bestandslisten, sondern blendete erst das Symbol des Justizministeriums der Föderation ein und dann ein wohlbekanntes, dennoch verhasstes Gesicht ein.
„Oh nein, nicht sie!“ spuckte Danny beinahe schon aus, als er die Person erkannte, die mit ihm sprechen wollte. Es war der einzige Mensch, den er derzeit noch mehr hasste als sich selbst.
„Ich verstehe gar nicht, wieso ich immer so unfreundlich begrüßt werde,“ meinte Edward Jellico und lächelte einladend. „Man kann nun nicht gerade behaupten, dass ich ihnen in letzter Zeit schlechtes wollte.“
Kurz überlegte der Sicherheitschef, ob er erneut eine bissige Erwiderung von sich geben sollte, entschied sich dann jedoch dagegen. Vermutlich legte es der ehemalige Admiral einfach auf diese Wortgefechte an. Der alte Mann schien es wohl zu genießen, wenn sich die Leute vor ihm ekelten.
„Wissen sie, Mr. Jellico, heute steht mir einfach nicht der Sinn nach langwierigen Diskussionen mit ihnen darüber, ob sie ein Verräter oder Held der Föderation ist. Ich habe andere Probleme und dringliche Arbeit, also werde ich einfach diese Verbindung beenden und ihren Anruf vergessen.“
„Dies ist aber schade, denn ich wollte ihnen gerade ein Angebot machen, dass ihnen vielleicht aus ihrer misslichen Lage heraushelfen könnte,“ erklärte Edward Jellico und ließ so Bird erstarren.
„Was meinen sie?“
„Ach kommen sie schon, haben sie etwa vergessen, was für Möglichkeiten mir zur Verfügung stehen? Ich bin ein Sonderarbeiter des Justizministeriums und habe da natürlich ihren Prozess sehr interessiert verfolgt.“
„Worauf wollen sie hinaus?“
„Mein lieber Danny, ich kenne doch ihre Art! Nach so vielen Jahren bin ich dermaßen vertraut mit der Crew der Monitor geworden, dass ich ganz genau weiß, was derzeit in ihrem Kopf vorgeht.“
„Und das wäre?“ fragte der Lieutenant und versuchte seine Anspannung nicht zu deutlich zu zeigen. Dieses ganze Gespräch machte ihm Angst und er hätte es am liebsten sofort beendet, doch irgendetwas hinderte ihn daran. Irgendwie schien von Edward Jellico eine unheimliche Versuchung auszugehen, die man nicht so einfach erklären konnte.
„Schuldgefühle. Reue und Hoffnungslosigkeit,“ beantwortete der Chefverschwörer von Sektion 31 seine Frage. „Sie fühlen sich schuldig für eine Tat, die sie nicht begangen haben.“
„Darüber kann man streiten.“
„In der Tat kann man dies und ich denke jeder wird in dieser Sache einen anderen Standpunkt besitzen. Der Punkt ist jedoch, dass Commander Kranick sie für nicht schuldig befunden hat und sie so mit weißer Weste vor der Sternenflotte dastehen. Was jedoch fehlt ist ihre persönliche Einsicht. Ihre Gefühle lähmen immer mehr ihre Arbeit und irgendwann werden sie nur noch ein Nervenbündel sein, welches nutzlos auf dem Schiff umher wandert, wie ein Geist. Aber ich habe die Lösung!“
Statt eine verbale Antwort von sich zu geben starrte Danny nur den Bildschirm an, der Jellico zeigte. Im Hintergrund war deutlich das Fenster seines Büros zu sehen, von dem man einen wunderschönen Ausblick auf den Eiffelturm hatte. Eigentlich wollte er nicht mit ihm diese Unterhaltung führen, doch noch immer wagte er es nicht die Verbindung zu unterbrechen.
„Ich möchte sie von ihren Schuldgefühlen befreien!“ erklärte Edward.
„Und wie wollen sie dies anstellen?“
„Auf ihren Wunsch hin werde ich die Löschung ihrer Erinnerungen veranlassen.“
„Wie bitte?“ Danny Bird meinte sich eben verhört zu haben.
„Keine Angst,“ beschwichtigte ihn der alte Mann, „ich rede nicht von ihren ganzen Lebenserfahrungen, sondern nur von den Erinnerungen rund um diesen Fall. Eine kurze Prozedur hier bei uns auf der Erde und schon werden sie sich nicht mehr an diese ganze Geschichte erinnern. Das Überlaufen, die Umprogrammierung, der Prozess, all dies wird für sie kein Thema mehr sein, denn ihnen wird es so vorkommen als seien diese Dinge niemals vorgefallen.“
Dies was er eben gehört hatte, war für den jungen Sicherheitsoffizier unglaublich. Für einen kurzen Moment ging er die verschiedenen Optionen des Angebots durch. Erschreckenderweise war es auf eine gewisse Art und Weise verlockend für ihn. All den Schmerz und die Trauer, die er derzeit empfand, einfach zu vergessen wäre ein Segen für ihn und vermutlich auch für seine Kollegen. Doch was wären die Konsequenzen hieraus?
Edward Jellico machte nie etwas nur aus purer Liebe zur Menschheit. Er würde einen Preis verlangen, auch wenn er ihn nun nicht aussprechen würde. Und wer wollte schon in der Schuld eines Mannes stehen, dessen Ziel die Zerstörung der Föderation war?
„Ihr lehne ihr Angebot ab.“
„Aber wieso denn? Es würde sie befreien,“ zeigte sich Jellico überrascht.
„Es würde die Tat nicht ungeschehen machen. Nur weil ich mich daran nicht mehr erinnern würde hieße dies nicht, dass es nicht passiert wäre. Und alle anderen wüssten auch davon.“
„Sie wären frei!“
„Nein,“ erklärte Bird grimmig, „ich stünde in ihrer Schuld. Mehr entfernt von der persönlichen Freiheit kann man dann nicht mehr sein.“
Nach diesen abschließenden Worten beendete Bird die Verbindung mittels Knopfdruck.
Ohne Verabschiedung, ohne weitere Worte. Es brachte nichts vor seinen Problemen davon zu laufen. Irgendwann musste man sich ihnen stellen. Doch zu allem Überfluss bemerkte Danny, dass ein kleiner Teil von ihm das Angebot des alten Mannes gerne angenommen hätte.
Hart und unsanft war das Wecken, welches Jozarnay aus dem Schlaf riss. Zaghaft öffnete er ein Auge und blickte in das freundlich lächelnde Gesicht von Tan. Dieser hatte einen Eimer Wasser über ihm ausgeleert und ihn so wach gemacht.
„Himmel,“ jauchzte Jozarnay, „wie spät ist es überhaupt?“
Ansatzweise waren die ersten Sonnenstrahlen zu sehen, die durch das karge Fenster schienen.
„Es ist Zeit, um mit der Suche zu beginnen,“ erklärte der Mönch mit der selben melodischen Stimme wie am Vortag. „Ich dachte es würde Zeit sparen, wenn ich dich gleich hier mit dem Eimer wasche. So musst du nicht wertvolle Minuten im Bad verschwenden.“
„Sehr rücksichtsvoll von dir, wirklich!“
„Komm, zieh dich an! Wir haben einiges vor.“
Pitschnass holte sich der ehemalige Chefingenieur ein Handtuch aus seiner Reisetasche und trocknete sich erst einmal ab, bevor er seine Kleidung anzog und endlich einmal auf die Uhr sehen konnte: es war 04:30 Uhr in der Früh! Etwas zu zeitig für Jozarnays Geschmack, der spät zu Bett gegangen war. Im Anschluss schlurfte er mit Tan in den Garten des Klosters, welcher die prächtigen Blumen der Mönche zeigten. Die Vögel begannen ihre Morgenlieder zu zwitschern und sanfter Tau rannte von den Blüten herab.
„Wir sind heute hier, um mit der ersten Phase deiner Suche zu beginnen,“ erklärte Tan und machte eine allumfassende Geste auf das, was vor ihm lag.
„Ah, ich verstehe,“ meinte Woil und sog ebenfalls die friedliche Atmosphäre in sich auf.
„Ich möchte, dass du dir dies hier ansiehst,“ meinte der junge Mönch und deutete auf die Steinwand, die sich hinter ihnen erstreckte. Jozarnay drehte sich ebenfalls um und erklärte:
„Es ist eine Wand.“
„Dies mag teilweise richtig sein, aber dort ist noch mehr. Sieh genauer hin!“
Jozarnay kniff seine Augen zusammen und starrte noch angestrengter die uralte Mauer an, ohne jedoch etwas besonderes zu finden. Die Wand zeigte Risse und manche Stellen waren nicht mehr richtig verputzt, aber ansonsten war an ihr nichts besonderes zu finden.
„Ich erkenne an ihr nichts besonderes?“
„Nein? Sieh genauer hin!“ forderte ihn der Mönch auf.
„Dies habe ich schon getan! Und ich sehe da nichts, was meine besondere Aufmerksamkeit erregen könnte. Was siehst du?“
Tan atmete einmal tief ein und aus, lächelte dann so wie er es immer tat und sagte in einem verliebten Tonfall:
„Ich sehe dort Gott.“
„Wie bitte?“ Jozarnay dachte er hätte sich verhört.
„Du hast mich schon richtig verstanden,“ erklärte der junge Antosianer, „in diesem alten Bau sehe ich Gott vor mir, den allmächtigen Schöpfer. Der erste Schritt deiner Suche zur Beantwortung der Fragen aller Fragen liegt darin den Allmächtigen zu erkennen. Bisher hast du dies nicht geschafft, doch du wirst.“
Jozarnay trat irrationalerweise einen Schritt näher an die Wand heran und berührte sie mit seiner rechten Hand. Durch den physischen Kontakt versuchte er etwas besonderes herauszufühlen, doch es gelang ihm nicht.
„Ich verstehe nicht, was du meinst,“ gab er verwirrt zu.
Tan kam ebenfalls einen Schritt näher, legte seine linke Hand an die Wand und blickte gen Himmel. Er dachte für einen kurzen Moment nach, bevor er erklärte:
„In dieser Wand steckt Gott. Sie wurde erbaut von Arbeitern, Antosianern, die nach seinem Antlitz und durch seine Macht erschaffen worden sind. Der Stein und der Lehm, der sie zusammenhält, wurden aus Materialien produziert, die er uns gegeben hat. Die Mauer schützt uns vor Wind und Regen, Sonne und Kälte; Dinge, die der Schöpfer steuert. Bezogen auf all die anderen Sachen, die du täglich siehst, kannst du sagen: in ihnen allen steckt Gott. Sie alle sind ein kleines Wunder, nur nehmen wir sie leider nicht mehr als solche dar. Sie sind zu selbstverständlich geworden. Verstehst du?“
Woil nickte und entgegnete:
„Ich teile deine Ansicht nicht, aber ich verstehe sie.“
„Dies ist gut,“ freute sich der junge Mönch, „denn verstehen ist der nächste Schritt bei deiner Suche. Komm, lass uns weiter forschen!“
Auf der Brücke herrschte eine entspannte Atmosphäre , hervorgerufen durch den Dockaufenthalt. An den Stationen saßen vornehmlich junge Offiziere, die die Zeit so nutzen konnten, um sich mit den Geräten und Aufgaben vertraut zu machen. Ardev betrat das Nervenzentrum des Schiffes und näherte sich sogleich der wissenschaftlichen Station, an der Arena saß.
„Kann ich mal eine Minute mit dir sprechen?“ fragte er die Terellianerin direkt.
„Sicher! Was gibt es denn?“ fragte Lieutenant Tellom und lächelte ihn erwartungsvoll an.
„Ich dachte da eher an ein Gespräch unter vier Augen,“ erklärte ihr andorianischer Ehemann mit leiser Stille und sie erhob sich von ihrer Arbeitstation, folgte ihm ins gemeinsame Ehequartier.
„Und? Was ist denn so wichtig, dass wir hierher kommen müssen?“
Ardev blickte sie traurig an und überlegte, wie er die Sache am besten angehen sollte. Welche Vorgehensweise würde die sein, die letztendlich am wenigsten Schaden verursachen würde? Letztendlich entschied er sich für die direkte Variante.
„Ich habe dein Programm entdeckt,“ erklärte er.
Arenas Miene verfinsterte sich für einen Moment, dann jedoch nahm sie wieder neutrale Züge an und meinte:
„Keine Ahnung, wovon du sprichst.“
„Ach, hör auf mir mit diesem Blech auf! Die Projektion Bolars habe ich während der Routineüberprüfung in deinem Speicherverzeichnis gefunden. Ehrlich gesagt hatten wir beide sogar schon eine intensive Diskussion.“
Nun war es seiner Ehefrau deutlich anzumerken, dass sie nichts mehr verheimlichte. Niedergeschlagen setzte sie sich auf die Kante des gemeinsamen Ehebettes und starrte vor sich hin.
„Ich habe dir die Tötung dieses Kriminellen verziehen,“ erklärte der Andorianer ihr, „aber ich verstehe beim besten Willen nicht, wieso du dieses Programm installiert hast. Dieser Mann ist gefährlich.“
„Mir wurde es ausgehändigt. Scheinbar hatte es sich in seinem persönlichen Nachlass befunden, adressiert an diejenige Person, die ihn schlussendlich töten würde.“
Ardev setzte sich neben seine Frau auf die Bettkante und umarmte sie liebevoll. Vorwürfe würden in dieser Situation überhaupt niemanden weiterbringen. Worauf es nun ankam war eine Aufarbeitung der ganzen Geschichte.
„Und wieso hast du die Datei nicht gelöscht?“
„Ich wollte Bolar kennenlernen,“ gestand Lieutenant Tellom offen und ehrlich. „Ich wollte wissen, wem ich das Leben genommen habe und mir wurde bewusst, dass dieser Mann kein geisteskranker Irrer war, sondern das genaue Gegenteil. Er ist intellektuell, kann debattieren...“
„Und er hat deinen Bruder ermordet,“ erinnerte der Einsatzoffizier sie. „Hör zu, Schatz, ich weiß doch genau, worauf du hinaus willst. Von Bolar geht eine unheimliche Faszination aus. Selbst ich habe mich auf lange Gespräche mit ihm eingelassen. Er selbst mag tot sein, sein Gedankengut lebt jedoch weiter. Wir müssen ihn löschen.“
Überrascht sah die Wissenschaftlerin ihren Mann an. Scheinbar schien sie nicht ganz mit der Problemlösung Ardevs einverstanden zu sein.
„Dies können wir nicht machen!“ erklärte sie mit fester Stimme und erhob sich von der Bettkante. Ardev tat es ihr gleich.
„Wieso?“ fragte er überrascht.
„Weil wir damit das letzte Vermächtnis dieses Mannes zerstören. Diese Projektion Bolars ist das letzte Überbleibsel seines Selbst. Er mag ein Mörder sein, doch haben wir vielleicht nicht auch das Recht die Erinnerung an ihn zu bewahren? Um zukünftige Generationen zu warnen?“
„Du sprichst von ihm, als wäre es Bolar selbst. Doch bei diesem Programm handelt es sich nicht um ihn selbst, sondern nur um die Summe seiner Gedanken und Ideen.“
„Was sind wir Individuen denn?“ fragte seine Frau energisch. „Auch nichts anderes als die Summe unserer Ideen. Dürfen wir einfach so diesen Mann aus dem Universum löschen?“
„Er hatte kaum Skrupel deinen Bruder aus dem Gefüge unserer Welt zu entfernen,“ warf Ardev mit düsterer Stimme ein.
„Denkst du etwa ich ergreife Partei für ihn?“ schrie Arena aufgebracht, nachdem ihr Bruder Reno wieder in die Diskussion eingebracht worden war. „Ich selbst habe für Bolar nichts als Verachtung übrig. Aber ich habe ihn schon einmal unrechtmäßig getötet. Entsteht dadurch für mich nicht die Pflicht diesen Fehler zumindest ein wenig wieder gut zu machen?“
„Deine Gedanken ehren dich, aber ich teile deine Ansicht nicht. Es handelt sich nur um ein Programm und daher werde ich es löschen. Du kannst mich aufhalten, wenn du es willst.“
Der Einsatzoffizier machte Anstalten das Quartier zu verlassen und erwartete jeden Moment, dass seine Frau versuchen würde ihn zurückzuhalten, doch nichts dergleichen geschah. Scheinbar hatte sie sich damit abgefunden. Ardev seufzte. Dies würde die ganze Sache erleichtern.
„Sie wollten mich sprechen, Skipper?“
Commander Price war in das Büro des Captains eingetreten und hatte seine Arme hinter dem Rücken verschränkt. Dieses unwillkürliche Zurückfallen in normgerechtes Verhalten, welches so unüblich für den Halbbetazoiden war, war der beste Indikator dafür, dass etwas nicht stimmte. John Lewinski nickte und bot seinem Stellvertreter einen Platz an.
„Es ist das erste Mal, dass wir uns sehen, seit sie zurückgekommen sind,“ erklärte Captain Lewinski den Grund für den Besuch bei ihm, „und ich würde einfach eine ganz einfache Frage an sie stellen: wie geht es ihnen?“
Matt blinzelte überrascht, bevor er antwortete:
„Ganz gut, denke ich.“
„Sie denken?“
„Es geht mir nicht gut,“ gestand der erste Offizier.
„Wenigstens sind sie ehrlich zu mir!“ freute sich der Kommandant der Monitor. „Wie ist denn ihr Besuch zuhause verlaufen?“
„Sie benutzen das Wort zuhause so selbstverständlich, dabei ist mein Heim auf Rigel,“ widersprach Matt ihm und musste selbst über seine Worte schmunzeln. Mehr als einmal hatte er diesen industriellen Planeten verflucht, auf dem er aufgewachsen war und nun bezeichnete er ihn tatsächlich als seine Heimat. Wie doch die Zeit verging! „Nur weil mein leiblicher Vater auf Betazed lebt heißt dies noch lange nicht, dass ich irgendwelche Verbindungen dort hätte.“
„Nun, dies ist ihre Interpretation, Commander. Erzählen sie mir von ihrem Zusammentreffen mit Arsani Parul,“ forderte ihn Lewinski auf.
„Es war... ungewöhnlich. Und grauenvoll. Alles wirkte so gezwungen, obwohl sich Arsani echt Mühe gab. Aber ich konnte deutlich die Zwietracht in seiner Familie spüren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass seine Ehe nicht lange halten wird.“
„Und er sollte hoffen, dass manche Aasgeier von der Presse nicht allzuschnell von der Sache Wind bekommen. Sie könnten ihn zerstören.“
„Skipper, wieso fragen sie mich das eigentlich?“ wollte Matt von seinem Vorgesetzten wissen.
„Darf ich mich nicht nach ihnen erkundigen? Immerhin ist es in meinem Interesse, dass es allen Untergebenen gut geht.“
„Oh.“ Matt Price war über diese Aussage sehr überrascht. Immer noch schätzte er John Lewinski steifer ein, als er tatsächlich war. Inzwischen hatte sich sogar zwischen ihnen ein zartes Band der Freundschaft entwickelt, welches noch gepflegt werden musste.
„Ich selber habe ihnen den Mut gemacht diese Reise anzutreten,“ erläuterte den Captain, „und ich möchte sichergehen, dass sie diese ganze Sache nicht vielleicht als Fehler ansehen.“
„Fehler?“
„Erst wenn es zu spät ist, wird uns allen klar, dass wir zuwenig Zeit hatten,“ meinte Captain Lewinski traurig und blickte an seinem ersten Offizier vorbei. „Jahrelang hatte ich meinen Vater nicht gesehen. Auch die letzte Ehre konnte ich ihm nicht erweisen, bei der Beerdigung war ich nicht anwesend. Wie ich ihnen schon gesagt habe möchte ich nicht, dass sie jenen Fehler wiederholen. Nutzen sie diese einmalige Chance ihren Vater kennen zu lernen.
Arbeiten sie die Fehler der Vergangenheit gemeinsam auf und am Ende wird alles gut werden!“
„Wenn dies doch nur so einfach wäre,“ antwortete der Halbbetazoid düster und erhob sich von seinem Platz.
Endlich war man nach der gefährlichen Fahrt im Lager angekommen, in dem sich die Ärztegruppe einfinden sollte. Das ganze Areal wirkte auf keinen Fall so luxuriös, wie es die Mediziner wohl in ihren Krankenhäusern gewohnt waren. Die Unterkünfte, Behandlungsräume und sogar Operationsräume bestanden aus schlichten braunen Zelten, die aufgrund der starken Windentwicklung hin und her wackelten. Die Stromversorgung war mangelhaft und reichte nur für die wichtigsten Installationen. Was einen jedoch am meisten erschreckte waren die Tausenden von Talarianern, die hier auf Hilfe warteten. Die meisten von ihnen hatten schreckliche Verletzungen davongetragen, waren verbrannt und aschfahl. Auch hier war die Seuchengefahr immanent. Die Ärztegruppe wurde abgeladen und zu ihren einzelnen Unterkunftszelten dirigiert, wo sie sich etwas häuslich einrichten sollten. Elisabeth Frasier betrat ihren kleinen Wohnraum und legte ihre Reisetasche ab. Hastig legte sie einige Kleidungsstücke in eine Metallkiste, die vor ihrem schlichten Feldbett ab und wollte sich schon auf den Weg nach draußen machen, da betrat jemand ihr Zelt. Es handelte sich um Commander Sokol.
„Wie ich sehe,“ meinte er mit seiner volltönenden und dennoch sanften Stimme, „haben sie sich hier schon etwas eingerichtet.“
„Soweit, wie dies hier überhaupt möglich ist,“ war die trockene Antwort Frasiers.
Sokol trat einen Schritt näher und setzte sich auf die Metallkiste, blickte leer vor sich hin.
„Ich bin froh, dass sie meine Anwesenheit nicht allzu sehr zur Kenntnis genommen haben. Dies hätte ansonsten vielleicht eine Gefahr für meine Sicherheit bedeutet,“ erklärte der Romulaner.
„Es war gelinde gesagt eine Überraschung für mich sie hier zu sehen.“
„Na ja, besser hätte es ja für die Sternenflotte nicht laufen können. So kann ich ihrem Oberkommando immer die neusten Berichte von Talar schicken.“
Sokol wirkte bei diesen Worten fast schon enttäuscht.
„Sie haben sich freiwillig dazu entschlossen der Sternenflotte Informationen zu liefern,“ erinnerte Elisabeth ihn.
„Ja, da haben sie recht,“ entgegnete der Romulaner und erinnerte sich an sein Gespräch mit Captain Lewinski:
Das Geheimdienstschiff Monitor hatte nach ihrer Rückreise vom Planeten Chervas 3 an die Starbase 67 angedockt, ihrem Heimathafen. Es war schon einige Zeit her gewesen, dass sie sich hier befunden hatten und obwohl dies hier nicht die Erde war, so fühlten sie sich doch alle sicher und geborgen, so als sei dies ihr richtiges Zuhause. In gewisser Weise waren sie dies auch, denn die Sternenbasis stand offiziell unter dem Oberkommando des SFI und beherbergte Dutzende Schiffe und Agenten. Manchmal fiel es John Lewinski schwer an diese Wirkungsstätte zurückzukehren, einem Bereich, der früher einmal die Domäne von Admiral Kashari gewesen war. Auch wenn der alte Zakdorn schon über zwei Jahre tot war, so vermisste John ihn immer noch. Der Admiral war mehr als ein einfacher Vorgesetzter gewesen, sondern ein Mentor und Freund. Ohne Kashari wäre der Captain wohl niemals zum Geheimdienst gekommen und hätte wohl auch niemals das Kommando über die Monitor erhalten. Nun gab es nach Kashari und dem getöteten Verräter Waseri einen neuen Sektorchef des Geheimdienstes, Admiral LaToya. Er kannte die Brasilianerin nicht allzu gut, doch ihr Ruf eilte ihr voraus: eine kompromisslose Frau, die sich beständig in der Hierarchie des Geheimdienstes hochgearbeitet hatte. Zwei geschiedene Ehen zeugten von ihrer Liebe zur Arbeit. Heute würde Captain Lewinski ihr zum ersten Mal gegenübertreten und seinen Bericht abgeben, zudem wollte er seine Einsatzempfehlung formulieren. Bevor er jedoch die Admirälin besuchte begab er sich noch einmal in das kleine Casino der Monitor. Dort saß Commander Sokol, der romulanische Kommandant, und wartete wie befohlen. Sokol hatte mit seinen Soldaten einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass sie die brenzlige letzte Mission überlebt hatten und nach dem erfolgreichen Verlassen des kontaminierten Planeten waren die Romulaner, aller Sicherheitsbedenken zum Trotz, mit ihnen geflogen. Als sich die Schotts des Casinos zischend öffneten und Lewinski das Casino betrat, erhob sich Sokol höflich und nickte ihm zu.
„Danke, Commander, dass sie auf mich gewartet haben,“ begrüßte ihn John und bedeutete ihm mit einer Hand sich wieder zu setzen.“
„Es gibt ohnehin nicht viele Orte, an die ich hier hätte gehen können,“ entgegnete Sokol und spielte damit auf seine Zugangsbeschränkungen an.
„Es tut mir sehr leid, Sokol, jedoch müssen sie während unseres Dockaufenthaltes hier an Bord bleiben. Wir haben jedoch schon ihre Regierung verständigt und ein romulanisches Schiff ist hierhin unterwegs, welches sie schon in ein paar Stunden abholen wird.“
„Sehr freundlich von ihnen, Captain Lewinski,“ bedankte sich der Befehlshaber und blickte traurig die gegenüberliegende Wand an. „Man wird uns abholen und dann wieder in diesen unnötigen Krieg zurückschicken.“
Dies waren die Worte, auf die John als alter Geheimdienstler gewartet hatte. Nun galt es die Karten sicher auszuspielen.
„Ja, wenn er doch nur schnell zu Ende ginge.“
Statt einer Antwort nickte der Romulaner nur, was John zum Weitersprechen veranlasste:
„Wie sieht es mit ihrem Versprechen aus, sich bei mir für die Rettung zu revanchieren?“
„Ich stehe zu meinem Wort wie jeder ehrenvolle Romulaner... zumindest war dies früher einmal so,“ war die lächelnde Antwort Sokols.
„Haben sie ein Interesse daran diesen Krieg bald zu beenden? Ich meine damit nicht durch Waffengewalt, sondern durch einen schnellen Waffenstillstand?“
„Wie sollte dies möglich sein?“
„Nun, ich weiß es zwar auch noch nicht, aber unsere Diplomaten könnten sich sicher da etwas einfallen lassen. Die Politiker brauche nur etwas Informationen, mit denen sie gefüttert werden könnten.“
„Welche Arten von Informationen meinen sie?“
„Ich denke sie wissen genau was ich meine!“ meinte John und blickte Sokol in die Augen. Dies war nun der kritische Moment, in dem sich entschied, ob er Ja oder Nein sagte.
„Sie wollen, dass ich mein Volk verrate,“ sagte Sokol bitter.
„Um Gottes Willen, nein! Ihr Volk ist schon verraten worden und zwar von ihrer Führung. Worum bitte ich sie denn? Um Informationen, die ihr Volk gefährden könnten? Die eine Föderationsinvasion verursachen könnten? Ganz und gar nicht! Mir geht es nur um ihre Flottenverteilungen, ihre Frontberichte und andere Dinge, die den Krieg betreffen. Alles andere interessiert mich nicht.“
Der romulanische Befehlshaber dachte lange und angestrengt über diese Worte nach. So lange, dass John schon fürchtete versagt zu haben. Dann endlich nickte Sokol und signalisierte ihm so, dass er einverstanden war. Die Worte selbst konnte er jedoch nicht über die Lippen bringen.
„Und wir sind ihnen dankbar für alles, was sie bisher für die Föderation getan haben,“ munterte Elisabeth ihn auf, die natürlich nicht das Überlaufen des romulanischen Kommandanten vergessen hatte.
„Wenn sie das nächste Mal mit ihrem Captain sprechen, dann übermitteln sie ihm eine neue Nachricht von mir,“ bat Sokol sie.
„Um welche Nachricht handelt es sich?“
Der Romulaner dachte kurz darüber nach, wie er den Sachverhalt formulieren sollte, dann meinte er mit ruhiger Stimme:
„Sagen sie ihm, dass ich mehr denn je von einer Kriegslüge überzeugt bin. Während wir hier sprechen finden auf Remus geheime Offensiven gegen remanische Truppen statt, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Auch mir fiel es schwer an diese zu gelangen.“
„Dies ist tatsächlich neu,“ fand Elisabeth, „doch was hat dies hiermit zu tun?“
„Es macht für mich deutlich, dass die Remaner wohl mehr mit dem Anschlag zu tun hatten, als wir erwartet hatten. Wieso sonst toben seit Wochen dort Kämpfe? Ich an ihrer Stelle würde mir das ganze einmal näher ansehen.“
„Danke für den Tipp, ich werde es ihm bei unserer nächsten Kommunikation ausrichten,“ versprach sie.
„Eigentlich hatte ich gehofft, dass man mich nach diesem sinnlosen und falschen Krieg wieder nach Hause schicken würde, zu meiner Familie. Doch ich muss wohl einen zu guten Eindruck hinterlassen haben. Stattdessen bin ich nun der Befehlshaber dieser Installation und muss nun auf sie alle aufpassen.“
„Dies tut mir leid,“ antwortete die Ärztin ehrlich. „Wie lange waren sie schon nicht mehr zu Hause?“
„Ich habe meine Frau und meine beiden Söhne seit über einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Ich vermisse sie.“
An den Worten Sokols konnte kein Zweifel bestehen. Ersichtlich wurde dies an dem trüben Glanz, den seine Augen annahmen; eine Mischung aus Glücksseligkeit und leichter Tränen, wenn er an seine Familie dachte.
„Wenn ich ihnen einen Tipp geben darf?“ begann Sokol und blickte zu der menschlichen Ärztin hoch.
„Bitte!“
„Genießen sie das Leben,“ riet ihr der Romulaner. „Suchen sie sich eine Liebe und verbringen sie so viel Zeit wie möglich mit ihr. Erfreuen sie sich am Leben, lachen sie mit ihr. Streiten sie sich mit der Person, die sie lieben und halten sie gleichzeitig zu ihr. Alles ist besser, als hier an diesem verfluchten Ort zu sein.“
Die Worte trafen Elisabeth beinahe wie ein Schlag, hatte sie doch in den letzten Tagen so gut es geht versucht ihre Probleme mit Matt Price zu vergessen. Doch die Worte Sokols hatten ihre eigenen Gefühle schmerzhaft wieder an die Oberfläche geholt. Sie konnte diesen rätselhaften Mann einfach nicht vergessen. So sehr sie sich auch bemühte, ihre Gedanken kehrten immer wieder zu ihm zurück.
„Ist es wirklich so schlimm?“ fragte Elisabeth und wollte das Gespräch auf ein anderes Thema lenken.
„Es ist ein Alptraum. Ich habe schon einiges gesehen in meinem Leben, doch Talar gehört mit zum schlimmsten. Verhungernde Kinder, die durch die Straßen streifen, überall nur Leichen. Ratten, die sich an ihnen weiden und so nur noch mehr Krankheiten verbreiten. Und dann dieser Geruch... er scheint niemals zu vergehen. Gemeinsam mit dem Hauch des Todes ist er das schlimmste.“
„Sie benutzen die gleiche Formulierung wie die Talarianer,“ stellte die Bordärztin fest.
„Hier sind wir alle gleich. Gleich in unserem Elend,“ meinte Sokol düster und erhob sich von seinem Platz. „Captain Lewinski hat mich gebeten auf sie acht zu geben und dies werde ich auch tun. Ab und an werde ich mal ein Auge auf sie werfen. Hoffentlich können sie hier etwas bewirken.“
„Dies hoffe ich auch,“ antwortete Elisabeth, doch der Commander bekam ihre Antwort schon nicht mehr mit. Er hatte das Zelt verlassen.
Die Bordärztin des Raumschiffs Monitor dachte noch einige Zeit über die Worte nach, die der romulanische Befehlshaber an sie gerichtet hatte. Dann richtete sie sich auf, wollte sich an die Arbeit machen, denn dafür war sie schließlich hier. Sie verließ ihr Unterkunftszelt und stellte fest, wie angenehm beheizt es doch im Inneren gewesen war. Wie immer seid den letzten Wochen rieselten Schneeflocken vom bewölkten Himmel und der eisige Wind hauchte durch das Lager. Elisabeths Schuhe knarrten unter der Schneedecke, als sie sich auf den Weg zum Behandlungszelt machte. Dort stellte sie, sehr zu ihrer Freude fest, dass sich Dr. Ixa ebenfalls hier eingefunden hatte, um mit ihrer Arbeit zu beginnen. Die Denobulanerin war hier an diesem Ort wohl das eheste, was einer Vertrauten gleichkam und so fühlte sich Elisabeth in ihrer Nähe äußerst wohl. Ixa war ebenfalls ihr Entsetzen über die hier herrschenden Zustände deutlich anzusehen.
„Ich sehe wir hatten den gleichen Gedanken,“ meinte Elisabeth, nachdem sie das Zelt betreten hatte. Unmittelbar im Anschluss fühlte sie sich von dem Gestank, der hier drin herrschte, wie erschlagen. Überall wohin man auch sah lagen Talarianer auf provisorischen Betten und stöhnten vor Schmerzen auf. Es roch nach Schweiß, verbranntem Fleisch, Durchfall und Erbrochenen. Die Patienten waren verschiedenen Alters und aus allen Schichten der talarianischen Gesellschaft. Dr. Frasier zögerte kurz, entschloss sich dann dafür, dass er beste Schritt wohl wäre sich einfach ins Getümmel zu stürzen. Sie nahm sich den erstbesten Patienten vor, einen kleinen Jungen. Setzte man menschliche Maßstäbe an, so mochte er an die acht Jahre alt sein, doch bei dieser Spezies waren Vergleiche schwierig, da sie früher erwachsen wurden. Sein Krankenblatt wurde von einer talarianischen Schwester gehalten, die müde und vollkommen ausgelaugt schien. Dennoch schien sie nicht willens ihre Schicht zu beenden.
„Hallo du,“ begrüßte Elisabeth den kleinen Jungen und lächelte ihn an. Leider erwiderte der auf dem Bett liegende Talarianer diese Geste nicht, blickte sie stattdessen nur mit trostlosem Blick an. „Was hast du denn?“
„Er hat schweres Fieber und Durchfall,“ erklärte die Krankenschwester, ohne auf das medizinische Blatt sehen zu müssen. „Der Patient ist nicht in der Lage feste Nahrung bei sich zu behalten und hat seit Tagen nichts mehr zu essen. Bei seinem schweren Fieber läuft er Gefahr ins Koma zu fallen.“
Die menschliche Ärztin hatte sich die Erklärungen angehört und ging im Geiste die möglichen Behandlungsvarianten durch. Dann entschied sie sachlich:
„Verabreichen sie ihm ein Mittel gegen Fiber; ich denke da an Anticlerol, 50mg.“
„Haben wir nicht.“
Die Antwort traf Elisabeth Frasier wie ein Schlag. Kurz dachte sie sich verhört zu haben, doch dies konnte nicht sein.
„Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen,“ entgegnete sie. „Anticlerol ist das weit verbreitetste, weil effektivste Mittel bei diesen Symptomen.“
„Dies mag für die Föderation gelten, aber hier haben wir so etwas nicht. Eine Hilfslieferung ist auf dem Weg hierher, aber sie kommt noch nicht durch den Zoll.“
„Wie lange wird dies dauern?“ fragte Elisabeth entsetzt.
„Tage.“
Im Anschluss an diese niederschmetterten Worte packte Frasier die Krankenschwester am Arm und zog sie etwas von dem Krankenbett weg.
„Dieser Junge hat nicht mehr genug Tage, um zu warten,“ erklärte die Ärztin.“
„Ich weiß. Sie sind neu hier, nicht war?“
Frasier nickte.
„Dann müssen sie sich an einige unangenehme Wahrheiten gewöhnen,“ erklärte die Krankenschwester düster und rieb sich den Schweiß von der Stirn, was gegen jegliches Sterilitätsgesetz verstieß. „Sie können hier nicht jeden retten. Um ehrlich zu sein können sie kaum jemanden retten. Es geht nur darum so viele zu retten, wie möglich sind.“
Entsetzt blickte Frasier die Schwester an. Natürlich ging man dieses heikle Thema während des Studiums durch, aber damit konfrontiert zu werden war eine ganz andere Sache.
„Dies glaube ich nicht,“ meinte sie mit fester Stimme, „es muss doch eine Möglichkeit geben diesem Jungen zu helfen.“
„Ja, die gibt es. Machen sie ihm seine letzten Stunden so angenehm wie möglich,“ erläuterte die Schwester und ging wieder zum Bett des Jungen, strich ihm traurig über den Kopf. Elisabeth blickte die beiden nur an und wurde sich schlagartig bewusst, dass diese Mission viel schwieriger war, als sie zu Beginn noch angenommen hatte.
Jegliche Warptests waren erfolgreich verlaufen und das Schiff war bereit für eine neue Aufgabe. Dies zumindest war die Ansicht des neuen Chefingenieurs Chief Miles O´Brien, nachdem er sich die Testergebnisse auf einem Datenpadd angesehen hatte. Auch der Maschinenraum war einer routinemäßigen Prüfung unterzogen worden und wie es für die Standards von O´Brien üblich war hatten sie ihn mit Bravour bestanden. Nun hieß es also warten, bis man endlich wieder etwas richtiges zu tun bekam. Der Ire kletterte die Leiter auf die zweite Ebene des Maschinenraums hoch und setzte sich in sein kleines Büro, wo er sich einige Crewbeurteilungen der Ingenieursbesatzung ansah. Manche seiner Untergebenen würden ein Lob verdienen und er wollte dies beim Captain vorschlagen. Seine Konzentration wurde jedoch durch den Türsummer gestört, der betätigt wurde. Miles warf einen Blick aus dem kleinen Fenster des Büros und sah zu seiner Überraschung Danny Bird vor dem Schott stehen. Er bat den Lieutenant herein.
„Lieutenant Bird,“ begrüßte Chief O´Brien ihn, „ich bin überrascht sie hier zu sehen. Was kann ich für sie tun?“
Der Anblick des Sicherheitschefs war schauderhaft. Danny wirkte leichenfahl, müde und leer. Es schien so, als würde er seit Tagen unter enormen Stress leiden, dabei saßen sie seit Wochen hier in diesem Dock fest. Was mochte da nur geschehen sein?“
„Darf ich kurz mit ihnen sprechen, Chief?“ fragte Danny und blickte den Chefingenieur ausgelaugt an. Selbstverständlich hatte dieser nichts dagegen einzuwenden und bot ihm einen Platz gegenüber dem kleinen Schreibtisch an.
„Also, womit kann ich ihnen dienen, Sir?“ fragte der Chefingenieur und faltete seine Hände vor sich auf dem Schreibtisch.
„Sie müssen mir einen Rat geben,“ gestand der Sicherheitschef ehrlich.
„Das werde ich gerne tun. Aber vorher müssen sie mir schon sagen, wie ich zu dieser Ehre komme.“
Bird schien etwas herumzudrucksen und zu überlegen, ob er mit der Sprache rausrücken sollte. Schließlich traute er sich doch.
„Wie mir zu Ohren gekommen ist waren sie schon oftmals in unkonventionelle Situationen verwickelt, wenn ich das so sagen darf?“
„Von welchen unkonventionellen Situationen sprechen sie denn?“ fragte Miles O´Brien lächelnd und imitierte dabei den Tonfall des Lieutenants.
„Nun, da gibt es einige Beispiele. Zum Beispiel ihre in den Akten dokumentierte Zeitreise in die nahe Zukunft, wo sie sich selbst getroffen haben. Oder das Ereignis, wo sie durch einen Doppelgänger vertauscht wurden. Dann ihre Anklage vor einem cardassianischen Gericht mit der Aussicht auf die Todesstrafe. Und nicht zu vergessen ihre illusionäre Freiheitsstrafe von 20 Jahren durch die Agrathi, welche in Wahrheit nur wenige Stunden gedauert hatte.“
„Das letzte von ihnen angesprochene Ereignis war das schlimmste gewesen,“ gab Miles zu und blickte kurz ins Leere. Nur zu deutlich entsann er sich noch an diese qualvolle Zeit, die sich nur in seinem Kopf abgespielt hatte und dadurch nur noch schlimmer gewesen war.
Erst die Aussicht seine Frau nie wieder zu sehen und dann zu erleben, dass sie alle keinen einzigen Tag gealtert waren, war äußerst verstörend gewesen.
„Hatten sie Schuldgefühle? Ängste?“ fragte Bird direkt.
„Ich hatte in der Tat Angst,“ gab der Ire freimütig zu. „Mir war nicht klar, wie mein Leben nun weitergehen sollte. Einfach alles vergessen und zum Status Quo wieder übergehen? Dies konnte ich mir beim besten Willen nicht vorgehen.“
„Aber?“
„Das Leben musste weitergehen. Irgendwann wurde mir klar, dass ich noch etliche Jahre vor mir hatte, die ich mit meiner Familie verbringen konnte. So grausam auch diese Erlebnisse gewesen waren, sie haben mich nur noch mehr in dem Gedanken bestärkt, dass das Leben etwas ist, was wir nicht einfach so wegwerfen dürfen. Es ist einfach viel zu kostbar.
Doch wieso fragen sie dies überhaupt, Lieutenant?“
Nun war es Bird, der an O´Brien vorbei ins Leere schaute. Er dachte kurz darüber nach, ob er überhaupt etwas von seinen Probleme erzählen sollte, dann jedoch wurde ihm klar, dass er schon längst den ersten Schritt getan hatte. Das Gute an der Sache war, dass O´Brien keinerlei Ahnung von dem hatte, was Bird zugestoßen war. Er war einfach noch nicht lange genug an Bord, um sich mit den Problemen der anderen Crewmitglieder befassen zu können.
„Ich habe etwas getan, was ich sehr bereue,“ erklärte Danny mit monotoner Stimme. „Es ist eine Sache, für die ich selbst nichts kann, aber die mich innerlich auffrisst. Jeden Morgen stehe ich auf und sehe im Spiegel nicht mehr mich selbst, sondern einen Schuldigen.
Fast schon scheint es mir, als verlange ich nach einer Bestrafung, um endlich diese Gefühle ablegen zu können. Ich fürchte ich werde bald nicht mehr in der Lage seinen meinen Dienst zu verrichten.“
O´Brien dachte kurz darüber nach zu fragen, um was für eine Tat es sich handeln mochte, entschied sich dann jedoch dagegen. Wenn der Lieutenant gewollt hätte, dass es bekannt würde, so hätte er es ihm selbst gesagt. So versuchte der Ire ihm auf diesem Wege zu helfen.
„Sind sie selbst von ihrer Schuld überzeugt?“ fragte er.
„Ja.“
„Sie fühlen Reue.“
„Auch das stimmt,“ gab Danny zu.
„Reue ist der erste Schritt zur Vergebung,“ fand der Chefingenieur.
„Ich bin nicht religiös, Chief.“
„Ich auch nicht, aber dennoch ist es ein weiser Satz. Sie selbst halten sich für schuldig. Ob diese Ansicht richtig oder falsch ist kann ich nicht beurteilen, wichtig ist jedoch, was sie selbst darüber denken. Und wenn sie selbst der Meinung sind sie hätten eine Strafe verdient, dann kann dies nur ein gutes Zeichen sein.“
„Gut?“ Danny war mehr als überrascht dies zu hören.
„Ja! Es beweist, dass sie noch genug Moral und Gewissen besitzen, um ihre Tat zu beurteilen. Sie sind keines dieser gewissenlosen Wesen, von denen es leider mehr als Genug im Quadranten gibt. Sie sind ein Mensch mit Werten und Idealen, und so lange sie diese so ernst nehmen, wie sie es jetzt tun, können sie noch nicht verloren sein. Geben sie sich selbst noch eine Chance! Noch haben sie die Möglichkeit ein erfülltes Leben zu führen. Sie sind durch ihre Selbstzweifel schon genug gestraft worden. Legen sie nun diese Probleme ab und leben sie wieder!“
„So einfach? Wir sprechen einfach darüber und schon ist das Problem für sie ausgeräumt?“
„Manchmal ist es das Beste einfach nur zu reden,“ riet O´Brien. „Wir müssen uns einfach nur mehr Zeit dafür nehmen.“
Dankend erhob sich Lieutenant Bird und atmete tief durch. Dies war nun schon die dritte Person, welche ihm geraten hatte endlich mit der Sache abzuschließen. Vielleicht waren es tatsächlich nicht die anderen, die falsch lagen, sondern er selbst. Möglicherweise war es an der Zeit sich selbst eine neue Chance zu geben. Eine Chance für einen Neuanfang, bei dem er wieder die moralischen Standards vertreten und verteidigen konnte, die für ihn so wichtig waren. Es war an der Zeit...
„Danke,“ meinte Danny und zum ersten Mal seit Tagen lächelte er wieder.
Forschen Schrittes betrat der Andorianer das kleine Holodeck der Monitor. An seinem selbstsicheren Auftreten und seinen Absichten gab es überhaupt keine Zweifel. Ardev hatte sich sein Vorgehen sehr genau und sehr sorgfältig überlegt, nun plante er es in die Tat umzusetzen. Mit gezielten Sprachkommandos aktivierte er das Programm wieder.
Wie aus dem Nichts, einer geisterhaften Vision gleich, erschien das holografische Antlitz Bolars vor ihm.
„Ah,“ meinte der alte Andorianer, nachdem er seinen Besucher wieder erkannt hatte, „ich hatte mich schon gefragt, wann sie mich das nächste Mal besuchen würden. Wenn ich den Chronometer richtig interpretiere ist einige Zeit seit dem letzten Mal vergangen.“
„Ich habe Zeit gebraucht,“ erklärte der Lieutenant. „Zeit, um zu einer Entscheidung zu gelangen.“
„Und wie ist diese ausgefallen?“
„Ich werde ihr Programm löschen.“
Ardevs Antwort war ehrlich und direkt gewesen. Es schien nicht so, als wäre Bolar überrascht von dieser Aussage. Ganz im Gegenteil, er nickte verstehend und begann in der Holokammer auf und ab zu gehen. Abermals glich er einem Professor, der nachdenken musste.
„Ich habe mit einer anderen Reaktion von ihnen gerechnet,“ gab der Einsatzoffizier zu.
„Mit welcher denn? Haben sie ein Rumzetern von mir erwartet, ein Flehen um ein Leben, welches schon vor einiger Zeit beendet worden ist.“
Ardev dachte über diese Worte nach und gab dann zu:
„Um ehrlich zu sein schon. Sie nehmen ihr definitives Ende sehr locker.“
„Mein junger Freund,“ erklärte Bolar und diesmal wehrte sich der Einsatzoffizier nicht gegen diese Anrede, „mein definitives Ende ist schon vor einiger Zeit eingetreten. Ich bin nicht Bolar, sondern nur dessen Projektion. Nicht einmal ein richtiges Leben bin ich.“
„Darüber lässt sich streiten,“ entgegnete Ardev und wunderte sich selbst darüber, wie nahe ihm auf einmal dieses Thema ging. Schließlich würde bald jegliches Vermächtnis dieses Mannes, so gefährlich er auch gewesen war, vernichtet sein.
„Eine Sache wäre da noch, um die sie sich Gedanken machen sollten,“ warf Bolar ein.
„Und die wäre?“
„Wie hat ihre Frau damals erfahren, dass ich noch am Leben bin und wo ich festgehalten wurde.“
„Man hatte ihr diese Information gegeben,“ erklärte Ardev.
„Wer gab ihr diese Information?“
Auf diese Frage wusste der Lieutenant keine Antwort. Auch er hatte erst vor kurzem davon erfahren, was seine Frau eigentlich getan hatte und dabei erfahren, wie sie zu der Information gelangt war. Dabei hatte er nie diesen Punkt beachtet, obwohl er eigentlich immanent wichtig war.
„Ich weiß es nicht,“ gab er schließlich zu.
„Wer immer ihnen dies mitgeteilt hatte,“ spekulierte die Abbildung von Renos Mörder, „der wollte hieraus einen Vorteil ziehen. Vielleicht können sie den Informanten finden, in dem sie sich fragen: cui bono?“
Statt eine Antwort von sich zu geben nickte Ardev nur. Er wollte nicht mehr länger mit dieser Figur sprechen. Er hatte das Gefühl er würde sich noch von ihm einnehmen lassen, wenn er ihm noch länger zuhörte. Also beschloss er es hier und jetzt zu beenden. Bolar erkannte an seinem Gesichtsausdruck, was der Einsatzoffizier vorhatte und atmete noch einmal tief durch.
„Danke, dass sie mir noch einmal die Möglichkeit für ein politisches Gespräch gaben,“ meinte er und er schien es in der Tat ernst zu meinen.
„Computer, lösche das derzeit laufende Programm aus allen Datenbanken.“
„Löschung wird durchgeführt,“ erklärte die weibliche Computerstimme und innerhalb einer Sekunde war die Projektion Bolars von der Bildfläche verschwunden. Nun war es endgültig vorbei.
„Ich weiß ja nicht so recht, aber ich bin auf meiner Suche noch keinen Schritt weitergekommen.“
Die Aussage Woils hallte in den weiten Hallen des Klosters tausendfach wieder und wirkte noch störender als sein bloßes Gerede. Er und Tan saßen im Schneidersitz in diesem Raum und versuchten zu meditieren. Was der junge Mönch mühelos schaffte gelang dem Antosianer ganz und gar nicht. Seit Stunden saßen sie hier und Jozarnay gab sich wirklich alle Mühe, um zum inneren Ausgleich zu gelangen, doch er schaffte es einfach nicht. Fast wäre er sogar schon eingeschlafen, doch zu seinem Glück hatte Tan davon nichts bemerkt.
Langsam löste sich der junge Mönch aus seiner Meditation, öffnete zaghaft erst das eine Auge, dann das andere und blickte den Besucher auf die selbe freundliche Art und Weise wie immer an.
„Du bist zu ungeduldig,“ erklärte er.
„Dies mag vielleicht sein,“ gab Woil zu, „ich schaffe es einfach nicht mich zu konzentrieren. Ich bin einfach zu unruhig.“
In Wahrheit wusste er ganz genau, woher diese Unruhe stammte, nur wollte er dies nicht vor dem jungen Mann zugeben. Ein Ausschluss aus dem Kloster wäre die Folge.
„Früher, so sagtest du, hast du auch meditiert.“
„Dies stimmt,“ bestätigte Jozarnay ihn. „Nur jetzt scheint es nicht mehr zu funktionieren.“
Tan richtete sich auf und der ehemalige Chefingenieur tat es ihm gleich. Beide gingen abermals in den Garten des Klosters, auf den beruhigend die Sonne schien. Es war ein mildes Wetter, ausgezeichnet um den Tag im Freien zu verbringen.
„Du bist nicht auf der Suche. Stattdessen willst du Gott wieder entdecken,“ stellte Tan fest.
Woil dachte einige Sekunden lang über diese Frage nach.
„Ja, ich habe früher einmal an Gott geglaubt,“ antwortete er und wunderte sich darüber, wie weit entfernt ihm diese Zeit auf einmal schien. Was war aus den Tagen geworden, wo Commander Price ihn um spirituellen Rat gefragt hatte.
„Und nun nicht mehr?“
„Nein.“
„Wieso?“ war die einfache und direkte Frage des Mönchs. Abermals blickte er ihn erwartungsvoll an, ohne Eile und voller Geduld. Er hatte eine Gelassenheit an sich, die Jozarnay fast wahnsinnig machte.
„Es ist... einiges vorgefallen. Dinge, die mir sehr viel Schmerz bereitet haben.“
„Körperliche oder seelische?“
„Beides,“ meinte Jozarany und spürte wieder die Schläge der humanischen Peiniger auf ihn einschlagen. Er musste sich beruhigen und versichern, dass er sich inzwischen in Sicherheit befand.
„Und diese Erlebnisse haben dich dazu bewogen sich von Gott abzuwenden?“
„Ich zweifle inzwischen an seiner Existenz,“ gab Jozarnay offen und ehrlich zu. „Früher, noch vor wenigen Wochen, trug ich ebenso langes Haar wie du. Ich war ein tatendurstiger und religiöser Mann, der gegen alle äußerlichen Widerstände an seinem Glauben festgehalten hat. Nun jedoch bin ich des Kämpfens müde. So oft habe ich für den Schöpfer eingestanden und was habe ich von ihm zurückbekommen? Gar nichts!“
Tan antwortete nichts, blickte stattdessen nur auf eine rote Blume, die bezaubernd aussah. Einige Minuten lang herrschte Schweigen zwischen ihnen, dann fragte Jozarnay:
„Was ist? Hälst du meine Worte für Blasphemie und sagst deswegen nichts mehr?“
„Nein, ich verstehe dich sehr gut. Viele Antosianer denken wie du. Sie haben sich vom Herrn abgewendet, weil sie keine irdischen Ergebnisse sehen. Dabei sind sie genau vor ihnen, nur wollen sie sie nicht sehen.“
„Wie meinst du das schon wieder?“
„Sieh dich an: du bist ein gesunder Mann, der noch sein ganzes Leben vor sich hat. Sie sind jung, haben eine gute Bildung und noch zwei lebende Eltern, die sie lieben und für sie da sind.“
„Du suchst nach Beweisen, wo keine sind,“ erwiderte der ehemalige Chief lapidar.
„Oder du weigerst dich zu akzeptieren.“
„Jetzt werde ich dir mal die Wahrheit sagen und dann hören wir mal, was du dann für kluge Sprüche von dir geben kannst,“ polterte Woil auf einmal los, in einer Art und Weise, wie er sie selber eigentlich gar nicht beabsichtig hatte. Es schien wie eine Lawine, die er losgetreten hatte und die er selber nicht mehr aufhalten könnte. „Dein Gott, der früher auch einmal mein Gott gewesen ist und eigentlich so toll sein soll hat mir schon zu Beginn meines Lebens das liebste genommen, was ich hatte. Meine Frau starb in einem sinnlosen Transporterunfall, einem Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit eigentlich so gering ist, dass es nicht passieren dürfte. Ich habe Kriege mitgemacht, in denen ich grausames gesehen habe und in denen ich töten musste, um nicht getötet zu werden. Letztes Jahr bin ich grausam gefoltert worden und fast gestorben. Noch immer wache ich nachts schweißgebadet auf, weil die Erinnerung an diese Schmerzen und meine Erniedrigungen mich heimsuchen. Und nun bin ich Sklave einer Droge, die ich inzwischen täglich konsumiere und von der ich nicht mehr wegkomme. Sie ist mein einziger Tag in einem Leben, welches schon mehrfach verpfuscht wurde.“
Wütend blickte Woil den jungen Mann an und fragte sich, ob dieser schon wieder dümmlich vor sich hin grinsen würde oder eine philosophische Antwort von sich geben würde. Wenn ja, so schwer er sich, würde er ihm das Nasenbein brechen. Doch stattdessen bemerkte man echte Betroffenheit in Tans Augen.
„Das sind schreckliche Dinge, die du mitmachen musstest und du hast mein Beileid dafür,“ entgegnete Tan und er schien es wirklich ernst zu meinen. Nur half ihm diese Antwort nicht im geringsten weiter.
„Ich habe in Gefangenschaft zu Gott gebetet,“ flüsterte Woil und musste sich zusammenreißen, um angesichts der Erinnerungen nicht loszuheulen, was ihm äußerst peinlich gewesen wäre, „und nichts kam. Keine Erlösung. Keine göttliche Hand, die mich herausholte. Stattdessen erwartete mich nur ein ewiger Kreislauf aus Fragen und Schmerzen. Es muss zu diesem Zeitpunkt gewesen sein, bei dem ich den Glauben an einen Gott verlor.“
Und bevor Tan eine Antwort von sich geben konnte rannte Woil davon. Wie so oft in letzter Zeit verschwand er, ohne sich zu stellen und versteckte sich in seinem provisorischen Schlafraum. Er wollte allein sein; allein in seinem Schmerz.
Commander Sokol saß an seinem Schreibtisch und wertete einige Berichte aus, die aus der Hauptstadt kamen. Immer noch kam es zu täglichen Angriffen auf die Besatzungstruppen, vornehmlich durch Bombenattentate und Heckenschützen. Und wenn er ehrlich war, so konnte der Romulaner den Talarianern dies nicht verdenken. Er würde ganz genauso handeln, wenn jemand Romulus besetzt hätte und der Bevölkerung seinen Willen aufzwängen wollte.
Romulus besetzen...
Hatte überhaupt irgendjemand ernsthaft angenommen, dass eine talarianische Invasion überhaupt möglich gewesen wäre? Wie naiv musste ein Volk sein, wenn sie diese Lüge glaubte? Oder war sich ein Großteil der Bevölkerung bewusst, dass sie angelogen wurden und es war ihnen dennoch egal? Von je her hatte eine äußere Bedrohung eine Bevölkerung vereint und so war dies oft ein beliebtes Mittel von Despoten gewesen, um von inneren Problemen abzulenken. War es hier ähnlich abgelaufen? Je mehr er darüber nachdachte, desto mehr wurde ihm Angst und Bange um die Zukunft des romulanisches Volkes.
Dr. Frasier stampfte wutentbrannt in sein Zelt und baute sich vor ihm auf. Ihm war auf der Stelle klar, dass es um eine Beschwerde ging. Langsam richtete er sich von der Straßenkarte auf und blickte sie erwartungsvoll an.
„Sie wollen sich beschweren?“ fragte er erwartungsvoll.
„Das haben sie aber schnell erfasst!“ wütete die Ärztin und deutlich war ihr anzumerken, dass sie noch nicht allzu lange hier war. Ansonsten würde sie nicht das sagen wollen, was sie im Begriff waren. „Sie blockieren uns!“
„Wie meinen sie das?“
„Ihr Programm ist scheinheilig,“ fand die Ärztin und kriegte sich in ihrer Wut nicht mehr
ein. „Sie rufen ein interstellares Hilfsprogramm ins Leben, angeblich um zu helfen und dann blockieren sie unsere Arbeit.“
„Und in wie fern tun wir die?“ fragte Sokol und faltete die Hände vor seiner Brust.
„Wieso verzögern sie die Einfuhr unserer Medikamente? Ohne sie ist ein Großteil der Patienten in unserem Lazarett zum Tode verurteilt.“
„Ich kann in dieser Hinsicht nichts machen. Mein Posten ist dieses Lagerkommandanten und kein Zollfunktionär. Ich kann natürlich eine Beschwerde an die nächsthöhere Dienststelle richten, aber das wird kaum...“
„Dann tun sie dies!“ forderte Elisabeth ihn zornig auf.
Auch wenn er es gut mit dieser menschlichen Frau meinte, so platzte Sokol der Kragen. Auch er hatte in letzter schlimmes durchgemacht und war nicht bereit sich an den Pranger stellen zu lassen.
„Sie müssen endlich aus ihrer föderativen Naivität aufwachen!“ schrie er zurück. „Was denken sie eigentlich, was sie hier tun sollen? Nichts anderes als den lebenden Beweis für die Political Correctness der romulanischen Regierung darzustellen. Sie sollen demonstrieren, dass wir bereit sind etwas für die Not leidende Zivilbevölkerung zu tun und um so besser bei den außerirdischen Regierungen dazustehen. Ob es Talar hilft ist für die da oben völlig irrelevant. Werden sie sich endlich ihres Platzes in diesem Spiel bewusst!“
Atemlos blickte die Bordärztin ihren Gegenüber an. Mit diesen schonungslosen Worten hatte sie beim besten Willen nicht gerechnet. Offen und ehrlich, so war Sokol zu ihr gewesen.
„Dann geben sie mir wenigstens einige Ampullen, mit denen ich Patienten künstlich ernähren kann,“ bat sie ihn. „Es würde uns etwas die Arbeit erleichtern.“
„Tut mir leid, dies kann ich nicht tun.“
„Wieso? Ich habe ihre Lagerlisten gesehen und sie müssten mehr als genug davon haben.“
Traurig blickte Sokol die Frau an. Irgendwie war ihr Enthusiasmus bewundernswert, aber konnte sie nicht verstehen? So einfach liefen die Dinge nicht.
„Diese Ampullen sind für romulanische Truppen vorgesehen und genau abgezählt. Ich kann keine davon rausgeben, da sie an anderer Stelle in meiner Armee fehlen würden.
„Die Talarianer, die aufgrund dieser fehlenden Ernährung dahinsiechen, wollen nicht sterben,“ erklärte Frasier düster.
„Dass wollten die romulanischen Soldaten, die hier sind, auch nicht,“ entgegnete Sokol mit ruhiger und fester Stimme. „Dennoch wurden sie von meiner Regierung in einen ungerechten Krieg geschickt. Es sind junge Leute, die noch ein gutes Leben vor sich hatten und dann aufgrund einer Lüge ihr Leben verloren. Verstehen sie doch bitte, wie gerne ich ihnen helfen würde, aber ich kann nicht. Auch ich muss an meine Leute denken.“
„Dann habe ich ihnen nichts mehr zu sagen.“
Niedergeschlagen verließ die Ärztin das Zelt des Kommandanten. Sokol blickte ihr noch einige Zeit nach und rieb sich dann müde über die Augen. Es waren diese Entscheidungen, die er so sehr hasste. Egal welche er traf, es würden Lebewesen sterben.
Was er auch tat, immer nur war der Tod die Konsequenz.
Wie er es schon erwartet hatte schlief seine Frau Arena schon, als er das gemeinsame Ehequartier betrat. Immerhin war es schon sehr später Abend und Lieutenant Tellom hatte trotz des Dockaufenthalts ihr volles Augenmerk auf die wissenschaftlichen Arbeiten gelegt. Kurz hielt der Andorianer inne, bewunderte das friedliche Gesicht seiner Frau. Dann küsste er sie sanft und Arena schlug langsam ihre Augen auf.
„Hallo,“ flüsterte sie und lächelte ihn an.
„Hi du,“ erwiderte Ardev den Gruß und fast waren all seine Sorgen vergessen. Er hatte gehofft mit der Löschung des Programms seinen endgültigen Frieden zu finden, doch dieser blieb ihm bisher versagt. Mit seiner letzten Frage hatte er ihm ein neues Mysterium aufgegeben, welches er lösen wollte.
„Es ist vorbei,“ erklärte der Einsatzoffizier und bezog sich auf die Löschung der Bolar-Projektion. Als Antwort drückte Arena ihn an sich und umarmte ihn, was eine überaus beruhigende Geste war. Zu gerne hätte Ardev den nun folgenden Punkt sein gelassen, doch er musste einfach weitermachen.
„Sag mal, Schatz, als du damals diese Nachricht bekommen hast, dass Bolar noch lebt... kanntest du den Absender?“
Kurz dachte sie nach, rieb sich verschlafen durch ihr Hand und richtete sich auf.
„Nein, ich.... der Absender war anonym und in meiner Wut habe ich dem kaum Bedeutung beigemessen. Diese Sache wird mir erst jetzt so richtig klar.“
„Du hast also keinerlei Ahnung?“ fragte Lieutenant Ardev noch einmal nach.
„Nein, wieso fragst du?“
„Weil ich gerne wissen möchte, wer dir diese Nachricht geschickt hat. Und was diese Person damit bezwecken wollte.“
Arena antwortete nicht und damit stand diese Frage im Raum. Zu dumm nur, so fürchtete Ardev, dass sich in der nächsten Zeit wohl nichts an diesem Zustand ändern würde.
Eigentlich hätte er wissen müssen, dass er in seiner Klosterunterkunft nicht vor der nervigen Präsenz Tans sicher war. Niedergeschlagen und frustriert saß Jozarnay Woil auf dem Klosterbett und starrte vor sich hin. Das Klopfen des jungen Mönchs an der Tür kam ganz und gar nicht überraschend für ihn. Er überlegte einige Zeit, ob er den Besucher hereinbitten sollte, doch dann nahm ihm Tan diese Entscheidung ab, indem er unaufgefordert den Raum betrat.
„Und was kommt jetzt?“ fragte der ehemalige Chief zynisch. „Wieder ein seltsames, kryptisches Rätsel, eine Erklärung, der niemand folgen kann? Was haben sie nun für mich auf Lager?“
„Nein, diesmal wähle ich eine andere Methode,“ erwiderte der junge Mönch. „Die des Verstehens.“
Woil weitete seine Augen, da er schon wieder nicht verstand, was Tan von ihm wollte. Wahrscheinlich würde er aus diesem Mann niemals schlau werden.
„Aber ich verstehe nun mal nicht,“ meinte er.
„Jedoch verstehe ich deine Sorgen.“
Mit dieser Aussage überraschte er Jozarnay und verursachte Staunen bei ihm.
„Wie meinst du das?“
Tan näherte sich noch ein wenig seinem unbequemen Bett und schien nach Worten zu suchen. Er überlegte, wie er das folgende wohl am besten sagen konnte.
„Auch ich war im Drogensumpf gefangen,“ erklärte Tan und schockte damit seinen Zuhörer. Mit dieser Entwicklung hatte er ganz sicher nicht gerechnet. „Ich war abhängig von einer Droge namens Tessin, welche ich schon als Jugendlicher jahrelang konsumiert hatte. Meine Eltern und Freunde hatten mich längst aufgegeben und ich selbst war zu verblendet um zu bemerken, wie ich mich immer mehr in den Abgrund drängte. Irgendwann nahm ich eine Überdosis und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ich lag kurz vorm Sterben. Einer der Ärzte schien sich tatsächlich um meine Zukunft zu sorgen und wies mich in dieses Kloster ein. Natürlich wollte ich am Anfang nichts von alledem hier wissen, ich wollte raus und wieder meinen Spaß haben. Doch nach und nach, es war harte Arbeit, befasste ich mich mit der Philosophie unserer Religion. Ich begann Literatur und Kunst zu studieren; Dinge, für die ich mich früher nie interessiert hatte. Und je mehr Zeit ich dem Lernen widmete, desto weniger Zeit hatte ich zum Konsumieren der Drogen. Irgendwann war ich davon los. Du siehst also, Jozarnay, ich habe sehr wohl eine vage Vorstellung von dem, was du durchmachst.“
Angesichts dieser offenen und schonungslosen Beichte konnte Jozarnay Woil nicht anders als seinen Gegenüber überrascht anzustarren. Dass dieser junge Mann, der so fest im Sattel seines Glaubens saß, ebenfalls einmal auf der schiefen Bahn gewesen ist, war kaum zu glauben.
War dies nicht der lebende Beweis dafür, dass man sein Leben wieder korrigieren konnte?
War es nicht doch möglich vom Ketracel-White wegzukommen?
„Ich danke dir für deine offenen Worte,“ erklärte Woil, „und ich bewundere dich für deinen Ehrgeiz. Ich beneide dich dafür von deiner Sucht losgekommen zu sein. Doch ich habe das Gefühl, als wäre diese Hoffnung bei mir vergebens. Zu viel habe ich in den letzten Monaten durchgemacht, als dass ich auf die erlösende Wirkung der Substanz verzichten könnte. In welches Leben sollte ich denn schon zurückkehren? Ich habe alles verloren. Der Spaß an der Freude ist das einzige, was mir bleibt. Daher gebe ich auf.“
Mit diesen abschließenden Worten erhob sich Jozarnay Woil von seinem Bett, packte seine Tasche und verließ das Kloster auf schnellstem Wege. Er hatte seine letzte Chance verspielt.
Tan blickte ihm noch einige Zeit lang traurig nach. Nun befand sich sein Leben in der Hand des Teufels.
Es hatte nicht lange gedauert, bis sie ihre Vorstellungen an ihren freiwilligen Hilfseinsatz beim interstellaren Ärzteeinsatz hatte anpassen müssen. Dr. Elisabeth Frasier war mit dem Ziel nach Talar gekommen zu helfen. Nun war es ihr Ziel so vielen zu helfen, wie es möglich war, auch wenn diese Zahl sich vielleicht nur auf 20 Prozent der Patienten belaufen würde. Innerhalb kürzester Zeit hatte Elisabeth die Ratschläge der talarianischen Krankenschwester beherzigt. Die Dame schien dies zu bemerken und gut zu heißen, denn inzwischen arbeiteten sie beide bevorzugt zusammen und waren ein gutes Team geworden. Frasier unterschrieb gerade die erfolgreiche Behandlung eines talarianischen Mannes, dem endlich einmal umfassend geholfen werden konnte. Dies war nicht weiter schwer gewesen angesichts der Tatsache, da sein einziges Problem ein verstauchtes Handgelenk gewesen war.
„So gut wie neu,“ erklärte Elisabeth und lächelte dem Mann zu.
Dieser brummte jedoch nur.
„Sie sollten etwas dankbarer dafür sein, dass wir sie so schnell behandeln konnten,“ fügte die Chefärztin der Monitor hinzu. „Viele haben weitaus schwerwiegendere Verletzungen und werden dieses Lazarett nicht lebend verlassen.“
„Als ob sie dies etwas kümmern würde,“ murmelte der Talarianer und machte Anstalten sich zu erheben, doch Elisabeth hielt ihn zurück. Erst wollte sie wissen, was diese Person gemeint hatte.
„Was wollen sie damit sagen?“
Wieder starrte sie der Talarianer an, schien zu überlegen, ob er überhaupt das Wort an sie richten sollte. Dann meinte er:
„Ihnen ist doch egal, was hier mit uns geschieht.“
„Wenn ich so denken würde, wäre ich gar nicht hier,“ erwiderte die menschliche Ärztin verwundert.
„Sie denken sie können ihre Schuld dadurch sühnen, dass sie hier Schadensbegrenzung betreiben. Doch dies reicht nicht. Ihre Einsicht kommt zu spät.“
„Was meinen sie?“
„Sie. Die Föderation. Der Alpha-Quadrant,“ erklärte der Mann zornig und blickte grimmig auf seine verbundene Hand. „Wäre ihnen irgendetwas an unserem Wohlergehen gelegen, so hätten sie niemals zugelassen, dass die Romulaner diese Welt vergewaltigten.“
„Hören sie mal,“ rief Frasier entsetzt auf, „sie haben wohl vergessen, dass wir gegen diesen Krieg waren!“
„Reden ist immer leicht, aber Handeln... das ist schon ein ganz anderes Kaliber,“ meinte er und seine Stimme bebte. „Wo waren denn die mächtigen Schiffe der Sternenflotte, als die romulanische Flotte Talar in Schutt und Asche gelegt haben? Wo waren da ihre Verteidigungsringe, als die Invasoren eine Welt nach der anderen eroberten? Haben sie überhaupt irgendeine Vorstellung davon, wie viele Talarianer in diesem Konflikt umgekommen sind? Zwei Milliarden und dies ist nur eine Schätzung.“
Fest blickte die Ärztin ihren Patienten an, doch sie wusste nicht recht was sie sagen sollte.
Zu ungeheuerlich wirkte auf sie dieser Vorwurf der Mittäterschaft. Sie alle waren doch hier um zu helfen, wie konnte man ihnen also dies vorwerfen.
„Zwei Milliarden Leben, getötet aufgrund einer Lüge, weil die romulanische Regierung ihren expansionistischen Drang befriedigen wollte,“ fügte der Mann hinzu. „Und auch jetzt unterstützen sie uns nicht. Sie sehen in uns Talarianern doch nichts weiter als Terroristen, obwohl unsere Angriffe auf romulanische Truppen nur unsere Freiheit zum Ziel haben.“
„Der Terror beginnt da, wo Zivilisten getötet werden,“ merkte Frasier traurig an.
„Nein, Terror liegt im Auge des Betrachters. Ob es sich um Rebellen, Widerstandskämpfer oder Terroristen handelt, ist immer die Sache des Bewertenden. Wenn sie tatsächlich mit uns mitfühlten, dann würden sie unseren Freiheitskampf unterstützen. Stattdessen erledigen sie die Lakaienarbeit der Romulaner. Nichts mehr!“
Mit diesen abschließenden Worten erhob sich der Mann und verließ auf eiligstem Weg das Behandlungszelt. Diesmal hielt Elisabeth ihn nicht auf. Zu schwer wog der Vorwurf auf ihren Schulter. Wie konnte man dies nur sagen? Irritiert trat sie ebenfalls aus dem Zelt heraus, um frische Luft zu schnappen. Immer noch schneite es, doch diesmal weniger stark als zuvor.
Was war dran an den Worten dieses Mannes? Wie viel Mitschuld trugen sie alle?
Ihre Gedanken wurden unterbrochen durch eine gewaltige Explosion am Horizont. Aufgeregt rannten Personen im Lager hin und her, als jedem bewusst wurde, dass ein Gebäude in der Stadt explodiert worden war. In der Ferne heulten Alarmsirenen auf und Shuttles begannen auf die Unfallstelle zuzufliegen. Im Lager wurde die Order ausgegeben sich auf weitere Schwerverletzte vorzubereiten. Ob Romulaner oder Talarianer die Urheber dieses Angriffs waren blieb nicht zu ermitteln. Frasier seufzte. Vielleicht war dies alles hier unten wirklich nur Ansichtssache.
Ende
based upon "STAR TREK" created by GENE RODDENBERRY
produced for TREKNews NETWORK
created by NADIR ATTAR
executive producer NADIR ATTAR
co-executice producer CHRISTIAN GAUS & SEBASTIAN OSTSIEKER
producer SEBASTIAN HUNDT
lektor OLIVER DÖRING
staff writers THOMAS RAKEBRAND & JÖRG GRAMPP and OLIVER-DANIEL KRONBERGER
written by NADIR ATTAR
TM & Copyright © 2005 by TREKNews Network. All Rights Reserved.
"STAR TREK" is a registered trademark and related marks are trademarks of PARAMOUNT PICTURES
This is a FanFiction-Story for fans. We do not get money for our work!
Nächstes Mal:

Quelle: treknews.de






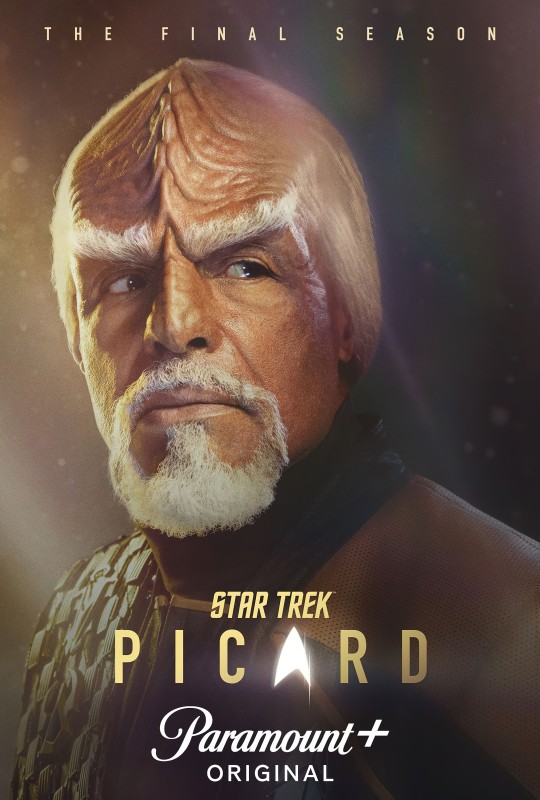



Empfohlene Kommentare
Keine Kommentare vorhanden