
Monitor 7x04 "Schuld"
Dateityp: zip
Größe: 0.30 MB
Der Anruf seitens James Talley hatte in Danny Bird eine innere Unruhe entfacht, die sich schon lange bei ihm aufgestaut hatte. Während der vergangenen zwei Stunden hatte er mit der Angst leben müssen, dass der Anführer der Föderalen Befreiungsarmee ihn enttarnt hatte und bald beseitigen würde. Seit ihm zum ersten Mal dieser Verdacht gekommen war hatte Danny alles versucht, um diese Schuld von sich abzulenken. Vor wenigen Minuten hatte James nun ihm eine Nachricht zukommen lassen, dass er unbedingt in den Garten des prächtigen lunaren Anwesens kommen sollte. Danny hatte wieder einmal seinen teuren Anzug angelegt, den er meistens bei Treffen mit Talley trug und hatte sich auf den Weg gemacht. Flüchtig blickte der Lieutenant auf die Uhr. Es war kurz vor sechs, auch auf dem Mond würde bald der Morgen grauen. Kurz fragte sich der Agent, wie lange er schon nicht mehr geschlafen hatte. Mehr als eine kurze Pause war ihm nicht vergönnt gewesen.
Und auch wenn es der Sicherheitsoffizier der Monitor nicht zugeben wollte, er hatte Angst. Angst davor, dass er gerade seine letzten Schritte als lebende Person machen und schon in wenigen Minuten tot sein würde. Was hatte er nicht alles in diese Mission investiert!
Seit drei Monaten befand er sich unter diesen Leuten, versuchte ihren teuflischen Plänen auf die Schliche zu kommen und gleichzeitig nicht von ihnen vereinnahmen zu lassen. Seit dem Beginn dieser Mission hatte Bird nicht mehr seine Freunde an Bord der Monitor gesehen, die er so sehr vermisste. Es war ihm nie bewusst gewesen, wie viel ihm die anderen bedeuteten. Möglicherweise war es nun zu spät, um ihnen dies jemals mitzuteilen.
Dannys Laune steigerte sich nicht gerade, als er in den garten des Anwesens kam. In dem von einigen Laternen erleuchteten Areal befand sich ein großer Teil des Führungszirkels der Untergrundarmee, inklusive Janine. Diese blickte ihn kurz an, als er die Treppen herunterstieg, schlug jedoch im Anschluss sofort ihren Blick nieder. Mit zusammengepressten Lippen musterte ihr Vater Danny, schien seine Gedanken oder Intentionen abschätzen zu wollen. Das ganze hatte irgendwie eine gespenstische Atmosphäre, beklemmend und unheimlich.
„Endlich bist du auch da!“ begrüßte James ihn mit ernster Stimme, nachdem sich Danny Bird in den Kreis der Anwesenden gestellt hatte, und trat selbst in die Mitte. Der Anführer atmete tief ein und aus, bewunderte einmal mehr das Wunder des Terraforming. Dass Menschen hier mal Sauerstoff atmen konnten, hätte noch vor einigen Generationen niemand für möglich gehalten. „In wenigen Minuten wird die Sonne aufgehen und damit auch ein neuer Tag anbrechen. Ein Neuanfang für jeden Bürger, der sich auf ein Neues daran macht in seinem Leben nach Glück zu streben. Die Altlasten des vorherigen Tages werden abgeworfen und man konzentriert sich auf die Zukunft. Genau dasselbe habe ich auch vor, “ erklärte James Talley und grinste fast schon freundlich. Beiläufig zupfte er an seinem Sack, strich seine Krawatte glatt und blickte dann zu Danny. Dieser hatte alle Mühe, um nicht instinktiv zurückzuweichen.
„In den letzten Stunden ist einiges passiert, meine Herren. Die Jagd nach einem potentiellen Verräter hat uns allen den Atem stocken lassen und mir vor allem eine schlaflose Nacht bereitet… genauso wie ihnen. Allein die Vorstellung, dass sich jemand gegen die Ziele unserer Gruppe stellt, ist für mich einfach nur widerlich und unfassbar. Dennoch hat es dieses Subjekt gegeben.“
Jetzt sagt er es, dachte Danny und gab sich alle Mühe keine Regung in seinem Gesicht zu zeigen, jetzt enttarnt er mich!
„Und nach langer Suche, “ erklärte James und hob nun seine Stimme an, so dass man ihn quer durch den Garten hören konnte, „haben wir endlich den Verräter in unseren Reihen gefunden.“
Danny wartete nur auf den Finger von James Talley, der in fast altmodischer Manier auf ihn zeigen sollte, doch stattdessen wandte sich der Anführer einer anderen Person zu: Nelson.
Dieser wich erschrocken zurück und blickte sich zu seinen Kollegen um, die ihn ebenfalls überrascht musterten.
„Ich?“ fragte das Führungsmitglied der Föderalen Befreiungsarmee ungläubig. „James, du glaubst ich würde dich verraten?“
„Ich glaube es nicht… ich weiß es!“
Rein äußerlich zeigte Danny Bird absolut keine Regung, innerlich jedoch fiel ihm ein Stein vom Herzen. Hatte es also tatsächlich geklappt, hatte er in der Tat den Verdacht auf Nelson lenken können? Die ganze Idee war eiligst zusammengeschustert worden und hatte kaum Aussicht auf Erfolg gehabt, doch scheinbar hatte der Lieutenant ganze Arbeit geleistet.
Abwehrend hob Nelson seine Hände, bemühte sich nicht noch einen weiteren Schritt nach hinten zu machen und eine selbstsichere Stimme zu haben, was ihm jedoch nur leidlich gelang. Der Vorwurf traf ihn dermaßen aus heiterem Himmel, dass er nicht in der Lage vernünftig zu reagieren.
„Wie kannst du mir dies nur vorwerfen, James? Wir kennen uns seit Jahren und verfolgen die gemeinsamen Ziele! Verdammt, ich habe diese Organisation mit dir aufgebaut und nun soll ich sie verraten? Denk doch mal vernünftig darüber nach!“
Doch in James´ Stimme war eine Kälte und Selbstsicherheit, die jeden im Garten, selbst seine Tochter, erschaudern ließ.
„Ich habe die Beweise in meinem Büro. Es hat mir das Herz gebrochen zu erfahren, dass du es warst, der Timo verraten hat. Wie konntest du nur? Wieso hintergehst du mich so?“
Nelson öffnete seinen Mund, als wollte er etwas sagen, doch es fiel ihm nichts ein. Instinktiv versuchte er zu fliehen, wurde jedoch von seinem rechten und linken Nebenmann festgehalten.
„Ich dulde keinen Verrat“, raunte James und holte einen Phaser hervor. Es bestand absolut kein Zweifel daran, was er damit vorhatte. Doch überraschenderweise wandte er sich an Bird.
„Töte ihn!“ befahl der Anführer und streckte ihm die Waffe entgegen.
Verwirrt musterte der Lieutenant sein Gegenüber.
„Wie bitte?“
„Töte den Verräter“, forderte James und drückte ihm die Waffe in die Hand. „Beseitige ihn und nimm im Anschluss seinen Platz in unserem Zirkel ein.“
Egal was er vorgehabt hatte, diese Dinge hatte Danny ganz gewiss nicht im Sinn gehabt. Nelson zu erschießen war ganz sicher nicht das, was er wollte. Doch scheinbar gab es keinen Ausweg. Irritiert betrachtete Danny die Waffe und stellte überflüssigerweise fest, dass sie auf Töten eingestellt war.
„Muss das sein?“ fragte Danny und versuchte die ganze Angelegenheit in eine andere Richtung zu lenken. „Lass uns ihn einsperren und verhören. Vielleicht können wir so mehr über seine Auftraggeber erfahren!“
„Nein. Auf Verrat steht bei uns der Tod. Töte ihn nun oder stell dich neben ihn!“
James´ Aussage war ernst gemeint. Verloren blickte Danny zu Janine, die jedoch seinen Blick nicht erwiderte. Von ihr oder den anderen im Garten konnte er keine Hilfe erwarten. Musste es also darauf hinauslaufen? Musste er einen Unschuldigen, auf den er die Beweise gelenkt hatte, töten? Drei Monate lang hatte Danny sich bemüht nichts Verbotenes oder gar Unmoralisches zu tun und nun das?
Langsam trat der Lieutenant vor und richtete den Phaser auf Nelson, der zu Boden gedrückt wurde. Der vermeintliche Verräter kniete vor seinem Henker und blickte ihm starr in die Augen. Am liebsten hätte Danny weggeschaut, als er abdrückte, doch er konnte nicht.
Er musste gegenüber den anderen eine Härte demonstrieren, die er nicht besaß. Aus dem Phaser löste sich der Energieimpuls und traf Nelson im Herzen. Das Geräusch seines auf dem Boden aufschlagenden Körpers hallte scheinbar noch minutenlang durch den großen Garten.
Noch einige Zeit lang schwiegen die Anwesenden im Garten der Residenz, blickten stumm auf den am Boden liegenden Leichnam. Auch noch Minuten später zielte Danny Bird Nutzloserweise mit dem Phaser auf den toten Nelson, so als ob er noch einen weiteren Schuss auf den vermeintlichen Verräter abgeben musste. Doch dem war nicht so. Zu groß war der Schock des Lieutenants darüber, was er eben getan hatte. Während der gesamten Zeit seiner Undercover-Arbeit hatte er versucht „sauber“ zu bleiben, sich also nicht in kriminelle und illegale Aktivitäten zu verstricken. Meistens hatte dies auch ganz gut geklappt. Bis zum heutigen Tage.
Nicht nur hatte Danny einen Unschuldigen töten müssen, auch war er der Grund hierfür gewesen. Bird selbst war es gewesen, der die vermeintlich diskreditierenden und dennoch gefälschten Beweise auf Nelson gelenkt hatte. Nelson war ein geeignetes Opfer gewesen, hatte er sich doch durch eine ständige Feindseligkeit gegenüber ihm hervorgetan sowie eine fast schon penetrante Nörgelei. Doch erst jetzt wurde dem taktischen Offizier der Monitor bewusst, was er getan hatte. Langsam schaffte er es den Phaser wieder zu senken und mit aller Mühe gelang es ihm James Talley anzusehen. Den Mann, der ihm den Befehl zum Todesschuss gegeben hatte.
„Wir werden Nelson beerdigen“, erklärte der Anführer der Föderalen Befreiungsarmee in Richtung aller Anwesenden, blickte dabei jedoch Danny weiterhin an. „Er mag zwar ein Verräter gewesen sein, nichtsdestotrotz war er ein Teil der Familie und ein guter Freund. Es ist mein Wunsch, dass er mit dem Respekt behandelt wird, den er auch verdient.“
Die anderen Führungsmitglieder, inklusive Talleys Tochter Janine, nickten.
„Ich werde mich um seine Beisetzung kümmern“, erklärte Beatrice Thomas, eine weitere Angehörige des Führungszirkels. „Gibt es einen bestimmten Termin, den du im Auge hast?“
„So schnell wie möglich“, entgegnete James Talley und seufzte fast unmerklich. „Nelson soll auf dem üblichen Friedhof beerdigt werden.“
Diese Aussage verursachte einige Unruhe bei den Anwesenden, war der angesprochene Friedhof eigentlich den verdienten Mitgliedern der Organisation vorbehalten. Nur wenige wollten, dass ein Verräter dort seinen Platz der ewigen Ruhe fand. Doch ein schneller und vor allem unmissverständlicher Blick seitens James Talleys ließ alle Nörgler verstummen.
„In den letzten Tagen und Wochen mag Nelson ein fehlgeleiteter Mann gewesen sein, aber man soll nicht seinen Einsatz für unsere Gruppe vergessen. Jahrelang hat er alles für die Armee getan und dies soll gewürdigt werden. Die Beerdigung wird an dem von mir angesprochenen Platze stattfinden. Danny, du wirst mit mir Nelsons Witwe aufsuchen. Es ist an uns die traurige Nachricht zu überbringen.“
Der angesprochene Mensch konnte nicht so recht glauben, was er da eben gehört hatte. Nicht nur hatte er der Henker Nelsons sein sollen, nun sollte er auch die Todesnachricht zu dessen Frau bringen? Scheinbar spielte James ein perverses Spiel mit ihm, denn eine andere Erklärung kam ihm beim besten Willen nicht in den Sinn.
Doch Danny wusste ganz genau, was gut für ihn und die Mission war und so antwortete er:
„Ist gut. Ich bin bereit, wenn du es bist.“
„Dann lass uns sogleich losfahren. Wir treffen uns in 15 Minuten an der Garage.“
Mit diesen abschließenden Worten löste sich die Versammlung auf und die Personen begannen die angesprochenen Tätigkeiten auszuführen. Nur Bird brauchte noch einen Moment länger und warf einen letzten Blick auf die Leiche. Sie lag auf dem Bauch, das Gesicht in das grüne Gras des Rasens vergraben. Instinktiv dankte er einer höheren Macht dafür, dass er nicht das Gesicht des Toten sehen musste, auch wenn es irgendwie pietätlos war. Die aufgehende Sonne warf einige bizarre Sonnenstrahlen auf den reglosen Leichnam. Die ganze Sache war ein Sinnbild für die Hinundhergerissenheit, die den Agenten beschäftigte. Wie sollte er nur Herr der Lage werden und mehr über die Waffe erfahren, die noch heute auf der Erde eingesetzt werden sollte?
Beim Vorbeigehen drückte Janine kurz seine Hand, versuchte ihm so etwas Trost zu spenden. Für Außenstehende schien sie eine willige Dienerin ihres Vaters zu sein, eine treue Gefolgsfrau. Was sie jedoch wirklich von dessen Taten dachte blieb selbst dem Lieutenant verborgen.
Schon seit wenigen Minuten befand sich das Außenteam wieder an Bord der Monitor, aber dennoch hatte es Captain Lewinski vorgezogen noch einige Minuten im Transporterraum seines Schiffes zu verbringen. Fähnrich Kensington und Chief Broome hatten auf Befehl des Kommandanten den Neuankömmling ins Casino gebracht, wo die nächsten Schritte vonstatten gehen sollten. John selbst wollte noch einen kurzen Moment über das eben geschehene nachdenken. Daher hatte er sogar den Transporterchef Alex Bolder gebeten seinen Arbeitsbereich zu verlassen. Schwer atmend legte Captain Lewinski einen Teil der Schutzpanzerung ab und bemerkte erst jetzt, wie sehr er schwitzte. Natürlich war das Material der Kleidung so ausgelegt, dass sie kühlend wirken sollte, dennoch hatte John das Gefühl in seinen Stiefeln würde sich das Wasser sammeln. Ob der Schweiß von der Anstrengung des Einsatzes oder der Nervosität herrührte konnte er nicht mit Bestimmtheit sagen. Auch legte er das Phasergewehr ab. Obwohl es kaum Gewicht hatte wog es schwer in den Händen des Kommandanten. Für einige Minuten blickte der Kanadier die Wand an, bis er von dem Zischen des sich öffnenden Schotts unterbrochen wurde.
Commander Price, sein erster Offizier, betrat den Transporterraum und betrachtete seinen Vorgesetzten. Auf ihn wirkte der Captain wie eine lebendige Leiche. Sein Gesicht war aschfahl, deutlich war ihm die Anstrengung anzusehen und mittels seiner empathischen Fähigkeiten konnte er ganz genau nachempfinden, was in dem Mann vorging.
„Was habe ich nur getan?“ fragte Lewinski mehr sich selbst denn sein Gegenüber und drückte damit genau das aus, was ihm durch den Kopf ging.
Betreten blickte der Halbbetazoid zu Boden und überlegte, welche Worte nun angemessen wären.
„Das, was nötig gewesen ist“, erklärte Price und klopfte dem Captain auf die schweißnassen Schultern. Dieser schnaufte nur verächtlich und meinte:
„Was nötig gewesen ist? Ich habe mich gegen die direkten Befehle des Präsidenten gestellt und einen Angriff auf eine Installation der Sternenflotte durchgeführt. Dies kommt einer Meuterei gleich.“
„Niemand wird davon erfahren, Skipper. Du hast alles Mögliche getan, um euer Eindringen zu verschleiern. Das Transportersignal ist unauffindbar, der Virus wütet da immer noch und ihr trugt keine Insignien, die euch als Sternenflottler hätten ausweisen können. Man wird es nicht erfahren.“
„Aber wir wissen es“, murmelte Captain Lewinski und blickte betreten zu Boden. „Aber wir wissen es…“
Nach diesen abschließenden Worten entschied John Lewinski, dass es keine Zeit mehr zu verlieren galt. Sie hatte einiges riskiert, um seinen Bruder Martin aus dem Gefängnis zu holen. Nun galt es zu schauen, ob dieser Mann die Mühen wert gewesen war…
Der Weg zum abgesperrten Casino, wohin man den Neuankömmling gebracht hatte, dauerte nicht lange. Innerhalb nur weniger Minuten waren Captain Lewinski und sein Stellvertreter dort angekommen. Auf dem Weg hatte sich John zahlreiche Gedanken darüber gemacht, wie sie nun vorgehen sollten. Vor allem stellte er sich die Frage, wie er nach fast einem dreiviertel Jahr der Gefangenschaft mit seinem Bruder umgehen sollte. Die ganze Sache war vertrackt, so viel stand fest!
Zischend öffneten sich die Schotts zum Casino, wo Martin Lewinski scheinbar brav an einem der Tische saß, bewacht von einem Sicherheitsmann. Die Hände hatte er gefaltet und auf den Tisch abgelegt, während seine Miene einen Ausdruck ehrlicher Geschäftstüchtigkeit demonstrierte. Nur noch die Kleidung enttarnte ihn als ehemaligen Gefangenen. Kein Wunder, dass er sich so lange mit seinen kriminellen Aktivitäten durchs Leben hatte schlagen können. Wer vermutete schon hinter diesem Gesicht einen kriminellen Waffenhändler?
Als John eintrat zeigte sich auf den Lippen seines Bruders ein leichtes Lächeln.
„Ich habe mich schon gefragt, “ begann Martin scheinbar vertrauensselig, „wann ich dir endlich für meine Rettung danken darf.“
„Um eines klar zu stellen: ich habe dich nicht gerettet, sondern dir bei einem Ausbruch geholfen und nur unter der Bedingung, dass du mir hilfst die Biowaffe zu finden, “ entgegnete der Captain und setzte sich auf den Platz gegenüber.
Doch Martin schien gar nicht auf seine Worte eingehen zu wollen. Stattdessen musterte er eindringlich die Decke, murmelte:
„Du weißt gar nicht, wie schön der beenget Platz eines Raumschiffes sein kann.“
„Ich kann es mir vorstellen.“
Die Erwiderung kam gelangweilt und ungeduldig über die Lippen Johns. Er hatte keine Zeit für die Spielchen, die sein Bruder scheinbar mit ihm spielen wollte. Nun zählte nur noch die Waffe schnellstmöglich zu finden und so der Bedrohung Einhalt zu gebieten.
Als Reaktion auf die Aussage seines Bruders veränderten sich die Gesichtszüge Martins. Augenscheinlich wurde er wütend und spannte seinen rechten Arm an.
„Ich glaube kaum, dass du dir dies vorstellen kannst. Vielleicht ist es mir ja entgangen, aber du hast nicht die letzten Monate in einem Gefängnis verbracht und auf winzigstem Raum gelebt! Also tu nicht so, als wüsstest du über was ich hier rede.“
Doch John war nicht in der Stimmung für Schuldzuweisungen oder ähnliches. Nur weil er seinen Bruder soeben illegal aus dem Gefängnis geholt hatte, hielt er seine Strafe nicht weniger gerechtfertigt als damals. Wenn es die Umstände zugelassen hätten, so würde Martin immer noch in der Zelle sitzen und seine Strafe verbüßen.
„Und genau dorthin wirst du zurückkehren“, drohte der Kommandant der Monitor, die deutlich machte, dass er es ernst meinte, „wenn du mir nicht endlich das gibst, was ich brauche: wie finde ich die Biowaffe?“
Eindringlich musterte Martin seinen Bruder, versuchte in seinen Gesichtszügen die Anzeichen eines Bluffs oder von Schwäche zu erkennen. Jedoch endete seine Suche erfolglos. Mit aller Seelenruhe lehnte sich Martin zurück, ließ seine Hände in den Schoß sinken und erklärte:
„Ich möchte erst einmal duschen.“
Fassungslos starrte John seinen Bruder an. Meinte er dieses Spielchen hier ernst oder was lief gerade? Unter größten Anstrengungen und dabei seine Karriere aufs Spiel setzend hatte er Martin aus einem Gefängnis der Föderation herausgeholt und nun wollte er ihm nicht bei der Suche helfen? Scheinbar verstand Martin Lewinski nicht die Dringlichkeit er ganzen Angelegenheit. John zögerte nur kurz, als er seinen nächsten Schritt plante. In einer fließenden Handbewegung holte er seinen Phaser hervor, den er immer noch an seinem Gürtel trug, und richtete die Waffe auf seinen Bruder.
„Auf deine Spielchen habe ich keine Lust“, erklärte der Captain und schaffte es tatsächlich so etwas wie Überraschung bei seinem Bruder zu verursachen. „Ich habe einiges riskiert, um dich aus dem Gefängnis zu holen und wir haben keine Zeit zu verlieren. Entweder du sagst mir jetzt, was ich wissen will oder wir beamen dich umgehend zurück in deine Zelle.
Die Wärter wären sicher begeistert dich wieder zu sehen!“
Mehrere Sekunden lang musterte Martin seinen Bruder, überlegte, ob dieser nur bluffte. Doch er schien John ernst zu nehmen.
„Die Biowaffen haben eine spezielle Signatur“, gestand Martin mit ruhiger Stimme. „Eine Art genetischer Fingerabdruck, mit dem man sie orten kann, wenn man die Sensoren richtig einstellt.“
„Wenn es so einfach wäre, wieso haben meine Spezialisten diese Möglichkeit nicht entdeckt?“
„Weil sie nicht explizit danach gesucht haben. Es handelt sich um einige sehr spezielle Justierungen, die man vornehmen muss.“
„Woher weißt du davon?“
„So etwas sollte man als Verkäufer wissen, findest du nicht?“
Diese Aussage kam wie ein Schock für John daher. Scheinbar bot ihm das Leben eine unangenehme Überraschung nach der anderen, wenn es um seinen Bruder ging. Nicht nur, dass Martin ein Waffenhändler war und dadurch Profit aus dem Tod anderer Leute zog, er vertrieb also sogar Massenvernichtungswaffen. Mit jedem neuen Detail, das John über ihn erfuhr, verachtete er seinen Bruder mehr und für diese Empfindungen schämte er sich.
„Kannst du diese Justierungen vornehmen?“ fragte Captain Lewinski mit Grabesstimme.
Sie war schon fast ein Flehen. Immerhin bot sich hier nun die Möglichkeit einen Fortschritt zu erzielen. Vielleicht die letzte vor der möglichen Katastrophe.
„Ja, dies kann ich. Dazu brauche ich nur Zugang zu deinen Scannern.“
Ohne ein weitres Wort zu sagen erhob sich John und packte seinen Bruder, schleifte ihn zur Brücke.
An einem gänzlich anderen Ort hatte eine Person derzeit alle Hände voll zu tun, um an das Ziel zu gelangen. Während das Eingreifteam der Monitor wieder im sicheren Hafen war, musste Jozarnay Woil um sein Leben rennen. Sein Ausbruchsversuch vor wenigen Minuten war geglückt und nun befand er sich auf der Flucht. Immer noch konnte der Antosianer es nicht glauben, dass der wohl älteste Trick der Welt funktioniert und die beiden Wachen hereingelegt hatte. Fast schon beschlich den ehemaligen Chief der Sternenflotte der Eindruck, dass die ganze Sache zu einfach war. Dann jedoch musste er sich selbst an seine derzeit problematische Lage erinnern. Nüchtern betrachtet sah seine derzeitige Lage alles andere als rosig aus: er befand sich auf der Flucht vor den Wachen von Edward Jellico, der ihn an einem ihm unbekannten Ort gefangen hielt. Weder hatte er irgendeine Ahnung, wo er sich eigentlich befand noch wo er hin musste oder mit wie vielen Wachen er es hier zu tun hatte. Rein nüchtern betrachtet waren seine Chancen hier lebend raus zu kommen fast Null. Doch Woil hatte noch nie etwas auf Zahlen gegeben. Früher, in den alten Tagen seines Lebens, hatte ihm die Religion Kraft gegeben. Sie war ihm eine Stütze gewesen, etwas, was ihm Trost gespendet hatte. Jedoch waren diese Zeiten vergangen. Schon vor langer Zeit hatte Woil seinen Glauben verloren. Woran er nun festhielt, war weitaus materieller und irdischer. Sein Körper zitterte, als er sich bewusst wurde, dass er dringend Ketracel-White brauchte. Während seiner Gefangenschaft hatten ihm die Wachen gerade genug gegeben, um das Minimum seiner Sucht zu stillen. Dementsprechend groß war seine Gier nach neuem Stoff.
Jozarnay Woil war alles andere als dumm. Die Zeiten, in denen er sich eingeredet hatte, nicht von der Droge abhängig zu sein waren schon lange vorbei. Dem ehemaligen Chefingenieur war sehr wohl bewusst, dass er ohne das White nicht sehr weit kommen würde. Aus diesem Grund musste er, bevor er überhaupt an eine Flucht denken konnte, sich erst einmal einen neuen Vorrat des Stoffs holen. Irgendwo in diesem Gebäude (?) musste es einen Raum geben, wo man das Ketracel-White, welches man ihm gegeben hatte, aufbewahrte. Diesen Ort galt es zu finden, bevor er sich Gedanken um das weitere Vorgehen machen konnte.
Sicherlich erhöhte sich das Risiko einer vorzeitigen Entdeckung in einem außergewöhnlichen Maße. Doch Woil musste nur seinen zittrigen Köper betrachten, um zu wissen, dass er ohne weiteres White nicht weit bei seiner Flucht kommen würde.
So leise wie möglich schlich der Antosianer durch die düsteren Gänge des scheinbar alten Gemäuers. Den Phaser, den er einer der niedergeschlagenen Wachen abgenommen hatte, hielt er verkrampft in seinen Händen, immer dazu bereit den tödlichen Schuss auf eine überraschend auftauchende Wache abzugeben.
Und tatsächlich tauchte ein Schatten am Ende des Gangs auf. Jozarnay hatte ihn gar nicht kommen sehen. Da war eine Person an dem Schott, welche sich in seine Richtung drehte…
Der Antosianer erstarrte, als er die Person erkannte. Dann lächelte er. Es war Stella Tanner, die Person, die ihn zu dieser Flucht überredet hatte. Sie stand dort, in einem atemberaubenden roten Kleid und lächelte ihm zu. Woil konnte nicht anders, als ihre Schönheit zu bewundern. Sie hob einen Finger und deutete auf das Schott, neben dem sie stand. Sofort begriff der ehemalige Chief, dass sie ihm den Weg wies. Es war wundervoll! Sie ließ ihn nicht im Stich, sondern half ihm in dieser schwierigen Phase. Anders als seine angeblichen Freunde und ehemaligen Kollegen von der Monitor war sie vor Ort und wollte ihm beistehen. Captain Lewinski hatte bei seinem „Besuch“ in der Zelle ja schon deutlich gemacht, dass man mit ihm nicht rechnen konnte.
Für Jozarnay spielte es keine Rolle mehr, dass Stella Tanner in Wirklichkeit schon tot war und er sich ihre Präsenz nur einbildete. Für ihn war diese Person, die er von Herzen liebte, einfach real und so folgte er ihrem Wink, der ihn hoffentlich in Richtung Freiheit bringen würde.
Wie so oft erwartete James Talley pünktlich auf die Minute auf den jungen Lieutenant.
Das exakte Einhalten von Zeiten und Auflagen war dem Anführer der Föderalen Befreiungsarmee ein besonderes Bedürfnis, welches er schon mehr als einmal bei seinen Besprechungen deutlich gemacht hatte.
„Wie soll man einen groß angelegten Plan verfolgen“, pflegte der schwarze Mann oftmals zu sagen, „wenn man schon am simpelsten Zeitmanagement scheitert?“
Ob Talley dabei an den Plan zur Zerstörung der Erde mit dem Biovirus gedacht hatte, wenn er diese Floskel aufsagte, war nicht bekannt. Jedoch ging Danny jede Wette darauf ein, dass seine Annahme zutraf. Hektisch blickte er auf seine Uhr. 06:19 Uhr FST. Angesichts der Tatsache, dass er sich schon seit gut 24 Stunden auf den Beinen befand fühlte sich der Undercover-Agent mehr als erschöpft. Zeitweise hatte er befürchtet einzuschlafen und nur mit einiger Mühe, sowie der massiven Einnahme von Koffein, hatte er dies verhindern können. Zwar hatte Danny gehofft auf der Fahrt zu Martha Nelson, der Witwe, schlafen zu können, doch auch diese kleine Hoffnung musste bitter enttäuscht werden.
„Du fährst“, bestimmte James Talley und bedeutete seinem jungen Zögling auf der Fahrerseite des Hoverautos Platz zu nehmen. Als Traditionalist hatte der ältere Herr ein Faible dafür entwickelt selber das Gefährt zu fahren bzw. fahren zu lassen, anstatt die Kontrolle gänzlich dem Autopiloten zu überlassen. Aus irgendeinem Grund schien er die menschliche Komponente den kalten Berechnungen des Computers vorzuziehen, auch wenn diese weitaus weniger fehlerbehaftet und unfallreich waren. Per Daumenabdruck startete Danny die Antriebe des kleinen Gefährtes, welches sich summend vom Boden erhob und aus der Ausfahrt des prächtigen Anwesens glitt. Zu dieser Tageszeit war noch wenig los auf den lunaren Straßen, erst in einer knappen Stunde würde der mäßige Berufsverkehr einsetzen.
„Es ist schon seltsam“, wunderte sich Bird und konzentrierte sich auf die Straße.
„Was meinst du?“ kam die prompte Antwort seines Beifahrers
„Die Affinität der Mondbewohner zu den Hoverautos. Auf der Erde würden sich die meisten Menschen einfach direkt von ihrem Haus zur Arbeitsstelle beamen lassen. Hier jedoch nehmen die Menschen eine mehrminütige Anfahrt in Kauf, die sie ihrer kostbaren Tageszeit beraubt. Ich wundere mich schon darüber, seit ich hier angekommen bin.“
Angesichts dieser nicht ganz ernst gemeinten Feststellung musste James schallend lachen, was überaus seltsam anmutete, wenn man an den Grund dachte, weswegen sie auf dem Weg zu Ms Nelson waren.
„Ich sehe, du hast in den letzten drei Monaten nur wenig von der lunaren Mentalität verstanden!“
„Findest du?“
„Ja, dies denke ich. Deiner Meinung nach sind die meisten Bewohner des Mondes etwas primitiv und rückständig, weil sie diese Art der Fortbewegung nutzen. Doch du irrst mit deiner Annahme. Viel mehr sind die Menschen hier bereit es etwas ruhiger angehen und sich nicht vom Diktat der Zeit beeinflussen zu lassen. Schau doch einmal aus dem Fenster und bewundere den wunderbaren Sonnenaufgang, der alles in ein wunderbares rot-orange taucht.“
Und um seine Aussagen zu untermalen deutete der Terrorist auf die vor ihnen liegende Umgebung, die in der Tat wunderschön war. Danny reckte etwas den Kopf und konnte am Himmel die Erde erkennen, den wunderschönen Ursprung der Menschheit. Den Ort, den James Talley vernichten wollte. Wie konnte man nur so etwas Zerbrechliches und schönes vernichten wollen? Wie gerne würde er James für das hassen, was er tun wollte und was er vor wenigen Minuten von ihm abverlangt hatte. Doch er konnte es nicht. Stattdessen bestimmte Unverständnis sein Denken über den dunkelhäutigen Mann.
Wieso hatte er ihm dies aufgebürdet? Hatte er mit der Ermordung Nelsons seine Loyalität testen und so sicher gehen wollen, dass er es nicht mit einem Spion zu tun hatte? Wenn ja, dann musste Lieutenant Bird hoffen seinen Gastgeber überzeugt zu haben. Denn viele andere Mittel und Wege, um seine Identität weiterhin geheim zu halten fielen ihm beim besten Willen nicht ein.
So fuhren die beiden über die Straßen des Mondes, ihrem Ziel entgegen. Dabei hatte Danny die ganze Zeit über das Gesicht des Mannes vor dem geistigen Auge, dessen Leben er zu seinem eigenen Schutz genommen hatte.
Für einen kurzen Moment hatte sich der Präsident den Zugriffen der Krise entzogen und sich in den privaten Bereich seines Arbeitsplatzes zurückgezogen. Der Grund dafür war ein nachvollziehbarer, er wollte mit seiner Frau sprechen.
In den vielen Jahrzehnten ihrer Ehe war seine Liebe für sie nicht verloschen, ganz im Gegenteil. In Zeiten wie diesen merkte er erst, wie sehr er sie brauchte und sie sein Leben komplettierte. Als er das gemeinsame Schlafzimmer betrat war seine Frau schon auf den Beinen und wie so oft fragte sie nicht nach dem Grund seines frühen Aufbrechens. Natürlich erzählte er ihr früher oder später von den Dingen, mit denen er sich beschäftigte, doch sie wartete immer höflich, bis der Präsident auf sie zutrat.
„Liebes“, begann er mit ruhiger Stimme, die Zuversicht ausstrahlen sollte, „du musst die Kinder nehmen und die Erde verlassen.“
Angesichts dieser doch recht plötzlichen Aufforderung blinzelte seine Ehefrau überrascht, legte ein Handtuch zur Seite, welches sie eben noch zusammengefaltet hatte und blickte ihren Mann mit jenem fragenden Blick an, den er so sehr an ihr liebte.
„Wieso denn das?“
Traurig seufzte der Präsident.
„Dieses Mal kann ich dir leider nicht davon erzählen, aber du musst mir glauben, dass es sehr, sehr dringend ist. Ich möchte, dass du auf der Stelle fliegst. Derzeit wird das Schiff fertig gemacht, um dich auf den Mars zu bringen.“
Seine Frau nickte und verstand.
„Du wirst wohl nicht mitkommen?“
„Nein, ich kann nicht. Meine Anwesenheit hier ist von größter Bedeutung.“
Als stumme Antwort umarmte seine Frau ihn, spendete ihm so neue Kraft und Zuversicht. Genau das richtige, was er nun brauchte.
Die Flucht in den privaten Raum dauerte jedoch nicht allzu lange. Sogleich, nachdem er den privaten Wohnbereich verlassen hatte, wartete schon Commander Elena Kranick auf ihn.
Ihr sorgenvoller Blick bereitete den Staatschef innerlich schon auf das vor, was nun kommen mochte. Die Krise währte erst einige Stunden, doch der Präsident fühlte sich, als wäre er um Jahre gealtert. So oft hatte er sich schon in schweren Zeiten betätigen müssen, z.B. während des Krieges zwischen den Romulanern und Talarianern oder den Ermittlungen gegen Sektion 31, doch niemals war die Erde so direkt bedroht worden. Bis heute.
„Was gibt es, Ms Kranick?“ fragte er und ließ sich von dem Sternenflottenoffizier in sein Büro begleiten.
In den beiden Händen hielt sie ein Padd, welches sie, typisch für eine Frau, vor der Brust hielt.
„Mr. President, ich habe eine schlechte Nachricht…“
„Es wäre nicht das erste Mal“, unterbrach er sie zynisch und bereute sogleich seine Worte. Nicht nur, weil es derzeit keinen Raum für Späße gab, sondern auch weil sie viel zu pessimistisch klangen. Noch war nichts verloren, noch bestand Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang der ganzen Sache. Innerhalb kürzester Zeit hatten sie wieder das Büro des obersten Führers der Föderation erreicht und er an seinem Arbeitsplatz wieder Platz genommen. Commander Kranick stellte sich vor seinen Schreibtisch und erklärte mit ruhiger Stimme:
„Wir haben eben einen Anruf von Captain Devol erhalten.“
„Captain Devol?“ fragte der Präsident. „Der Leiter des Hochsicherheitsgefängnisses, in dem Martin Lewinski festgehalten wird?“
„Ja, Sir. Das Gefängnis, in dem Lewinski festgehalten wurde.“
Überrascht wölbt der Präsident die Augenbrauen angesichts dieser von ihr veränderten Wortwahl und ihm schwante böses.
„Wurde? Wie meinen sie dies, Ms Kranick?“
„Es hat vor wenigen Minuten einen Angriff auf das Gefängnis gegeben. Drei vermummte Personen haben sich mit Gewalt Zutritt verschafft und Martin Lewinski befreit.“
Entsetzt erhob sich der Präsident von seinem Platz und stützte seine Hände auf dem hölzernen Schreibtisch ab.
„Wer waren diese Personen?“
„Dies wissen wir leider nicht. Die betreffenden Angreifer haben alles Mögliche getan, um ihre Aktion zu maskieren. Weder konnte man DNA-Spuren nachweisen noch waren die Kameras beim Zeitpunkt des Angriffs aktiv. Wir hatten es mit Profis zu tun.“
Einige Minuten lang ließ der Präsident diese Worte auf sich wirken.
„Profis…Männer mit guter Ausbildung…, “ murmelte der Präsident und begann für sich Schlüsse zu ziehen. „Noch vor einer Stunde hatte Captain Lewinski beantragt seinen Bruder freizulassen. Eine Bitte, die ich ablehnte.“
„Ja, Mr. President“, bestätigte Commander Kranick überflüssigerweise. Anscheinend war sie zu demselben Ergebnis ihrer Überlegungen gekommen wie der Staatschef.
„Besitzt die Crew der Monitor die entsprechen Ausbildung und Ausrüstung, um eine solche Aktion durchzuführen?“
„Ja… wie zahllose andere Einheiten der Sternenflotte auch,“ bestätigte Kranick. Auch wenn sie fast derselben Ansicht wie ihr Gegenüber war, so gefiel es ihr ganz und gar nicht einen anderen Offizier einer illegalen Aktion, die den Anweisungen des Präsidenten zuwider war, zu bezichtigen. Doch die Indizien waren nicht von der Hand zu weisen.
„Keine dieser anderen Einheiten hat mich jedoch um die Freilassung seines Bruders gebeten“, erklärte der Präsident mit Zornesstimme. Hatte er sich etwa so in einem anderen Menschen täuschen können? Bisher hatten ihm alle versichert es wäre eine gute Idee Captain Lewinski auf diese lebenswichtige Mission anzusetzen. Wurde sein Vertrauen nun so enttäuscht?
„Ich will auf der Stelle Kontakt mit der Monitor aufnehmen“, befahl der Präsident.
„Dies wird sofort erledigt…. Sir, sie sollten noch etwas wissen.“
Abermals konnte der Staatschef erkennen, wie sie herumdruckste und ahnte schon, dass sie ihn mit einer weiteren schlechten Nachricht schocken würde.
„Was ist es, Commander Kranick?“
„Bei der Befreiungsaktion von Martin Lewinski ist es zu einer Schießerei gekommen… und eine Wache des Gefängnisses ist dabei zu Tode gekommen.“
Eine schlimmere Nachricht hätte es für den Präsidenten derzeit nicht geben können. Nicht nur, weil er annehmen musste, dass ein Offizier der Sternenflotte gegen seine direkten Befehle verstoßen hatte, sondern dabei war auch ein eigener Mann ums Leben gekommen. Ein grauenvoller Tag!
„Stellen sie mich sofort zur Monitor durch“, befahl der Präsident und Commander Kranick schickte sich an seine Anweisungen zu befolgen.
Neue Geschäftigkeit herrschte auf der Brücke der Monitor. Grund dafür war Martin Lewinski und die neuen Informationen, die er mit sich gebracht hatte. Gleich nach ihrem Gespräch war er seinem Bruder in die Kommandozentrale gefolgt und hatte die Sensoren mit den Spezifikationen eingestellt, die sie für die Suche benötigten. Nun scannte Ardev an seiner Arbeitsstation die gesamte Erde.
„Eine recht mühevolle Variante, wie ich finde“, meinte der Andorianer und verschränkte die Arme vor der Brust, während er auf den Bildschirm blickte.
„Es gibt jedoch keine schnellere“, entgegnete Martin Lewinski und blickte triumphierend zu seinem Bruder, der ihn jedoch ignorierte.
„Was genau haben sie denn für Parameter eingegeben?“
„Ihre Scanner suchen jetzt gezielt nach einem speziellen Material, welches man nur in der Biowaffe finden kann. Die genaue Zusammensetzung dieses Virus ist immer noch ein Rätsel und so gut wie unerforscht. Ganz besonders für die Föderation, denn die hat sich aus Angst bisher jeder weiteren Forschung an dieser Waffe verschlossen.“
„Aus gutem Grund“, meinte Captain Lewinski, der sich nun in diese Diskussion einmischte. Dabei schien die gesamte Brückencrew seinen Worten zu lauschen. Das Familiendrama der Lewinskis war schon längst keine rein private Angelegenheit mehr. „Wieso sollten wir an einer Massenvernichtungswaffe herumforschen? Für so etwas Grauenvolles haben wir keine Verwendung.“
„Sieh, wohin euch eure Einstellung gebracht hat. Ohne mich besäßt ihr nun gar keine Informationen.“
„Eure Einstellung?“ John imitierte den Tonfall seines Bruders und schaffte es dabei noch einen Hauch von Unverständnis mitschwingen zu lassen. „Du bist ein Mensch, ein Bürger der Föderation. Dir sollten unsere Werte viel mehr liegen.“
„Ich bin nur mir selbst verpflichtet.“
Die Erwiderung Martins war so kalt, dass es John in seinem Herzen schmerzte. Ganz deutlich merkte dies Commander Price, der mittels seiner empathischen Fähigkeiten nur zu deutlich den emotionalen Schock in seinem Vorgesetzten spürte. Gerade in dieser Situation musste John jedoch Stärke beweisen, auch wenn es mehr als schwer fiel.
„Damals dachte wir alle Waffen vernichtet zu haben“, raunte Ardev und versuchte durch sein Einmischen das Duell der beiden Lewinski-Brüder zu beenden. „Ich selbst habe in einer Undercover-Mission diese Waffen aufgespürt.“
„Sie waren wohl nicht gründlich genug!“ war die lässige Erwiderung des Waffenhändlers.
„Und die Erde? Wäre es dir egal, wenn die Wiege der Menschheit bald nur noch ein gewaltiger Friedhof wäre?“
Die Frage Johns war berechtigt. Egal, was für eine Art von Krimineller sein Bruder auch war, bisher hatte er immer an einen kleinen Funken Anstand in ihm geglaubt. Bis heute.
„Wie gesagt, das Schicksal anderer interessiert mich nicht. Nur mein eigenes. Ich hoffe du denkst daran mich frei zu lassen, wenn wir das hier beendet haben.“
Bevor er darauf eine Erwiderung geben konnte, wurde Captain Lewinski durch Arena Tellom unterbrochen.
„Captain, wir empfangen eine Botschaft von der Erde“, erklärte die Terellianerin, „es ist der Präsident.“
Kurz blickte John zu seinem Offizier und konnte ihm deutlich ansehen, dass er dasselbe dachte. Nur wenige Minuten nach dem Ausbruch aus dem Gefängnis mit dem Präsidenten zu reden war mehr als nur ein Zufall.
„Legen sie das Gespräch auf den Hauptschirm, aber der Fokus soll nur auf mich gerichtet sein“, befahl Captain Lewinski und trat in die Mitte der Brücke, direkt vor seinen Stuhl.
Mit einer beiläufigen Geste strich er seine Uniform glatt und erwartete das Bild des Staatsoberhauptes auf dem Wandschirm.
„Mr. President, was kann ich für sie tun?“
Das Gesicht des Präsidenten wirkte so souverän wie immer, jedoch war ihm eine leichte Anspannung zu entnehmen. Und Ärger, dies konnte man bei genauerem Hinsehen herauslesen.
„Captain Lewinski, bitte erlauben sie mir die Frage, wie weit sie mit ihrer Suche sind.“
„Nun ja, wir sind immer noch dabei die verschiedenen Indizien auszuwerten und haben mit einem massiven Scan der Erde begonnen. Meine Experten hier an Bord verfolgen eine Spur, doch es ist noch zu früh, um darüber zu reden.“
Bedächtig nickte der Präsident, als er diese Informationen vernahm.
„Und diese Spur stammt nicht von einem externen Informanten?“ fragte der Präsident dringlich nach.
„Wie meinen sie das, Sir?“
Alle auf der Brücke beschlich ein ungutes Gefühl, als sie diese Frage vernahmen und die damit implizierte Vermutung. Der Fokus der Aufmerksamkeit legte sich auf den Kommandanten und darauf, was er nun sagen würde.
„Ich habe soeben beunruhigende Informationen bekommen, Captain. Es hat einen Angriff auf das Hochsicherheitsgefängnis Alpha gegeben, dem Ort, wo auch ihr Bruder inhaftiert ist.“
Im Anschluss an seine Worte machte der Präsident eine kurze Pause, um die Reaktion bei Captain Lewinski sehen zu können. Doch der Kanadier schaffte es auf bemerkenswerte Art und Weise eine Art Pokerface beizubehalten.
„Einen Angriff? Wissen wir, um wen es sich bei den Angreifern handelt und ob es etwas mit dem heutigen Anschlag zu tun haben könnte?“
„Die Urheber sind uns leider nicht bekannt, doch wir sind akribisch dabei die Spuren des Tatorts auszuwerten. Dies ist uns insofern wichtig, da bei dem stattgefundenen Schusswechsel ein Sternenflottenwachmann zu Tode gekommen ist.“
Die übermittelte Information änderte von einer Sekunde auf die nächste alles. Captain Lewinskis Augen weiteten sich, als er von dem Toten hörte und auch die anderen Offiziere wurden nervös.
„Ein Toter?“ fragte John mit trockener Kehle. „Um wen handelte es sich?“
„Um Petty Officer Jack Dwight. Zwar haben die Angreifer aus einem derzeit nicht näher bekannten Grund mit auf Betäuben eingestellten Waffen geschossen, doch der Petty Officer erlitt einen Kopftreffer, der aus nächster Nähe erfolgte. Er verstarb sofort.“
„Das ist… furchtbar…“ stammelte John und fing sich schon im nächsten Moment. Die ganze Situation entwickelte sich ganz und gar nicht so, wie er es erwartet hatte. Jemand war bei seiner illegalen Aktion ums Leben gekommen, ein Mitglied der Sternenflotte. Wer mochte wohl den tödlichen Schuss abgefeuert haben? John wusste es nicht. Die Welt um ihn herum begann sich zu drehen, als er sich der Konsequenzen seiner Entscheidung vor gut einer Stunde bewusst wurde.
„Wo waren sie eigentlich in den letzten beiden Stunden?“ fragte der Präsident.
„Sir?“
Lange starrte das Staatsoberhaupt seinen Gegenüber ab, wog seine nächsten Schritte ab. Dann entschloss er sich schließlich zum Vorstoß.
„Captain Lewinski, ich will ehrlich zu ihnen sein. Ich glaube, dass sie gegen meine Anweisungen gehandelt und in das Gefängnis eingebrochen sind, um ihren Bruder herauszuholen. Schlimm genug, dass sie einen direkten Befehl missachtet haben, doch angesichts der gegenwärtigen Krise bin ich bereit dies zurückzustellen. Übergeben sie Martin Lewinski, von dem ich glaube, dass er sich bei ihnen an Bord befindet, und wir verfolgen erst einmal die gegenwärtige Krise weiter.“
Lange dachte der Captain darüber nach, wie er nun reagieren sollte. Ein Bluff, eine Lüge oder doch die Wahrheit? So viel hatte er nun riskiert und dabei nicht abgewogen, dass tatsächlich jemand hätte zu Schaden kommen können. Schließlich traf er eine Entscheidung:
„Wir sind dabei die Waffe zu finden, Mr. President. Dies kann mir nur mit der Hilfe meines Bruders gelingen, der für diese Suche unentbehrlich ist. Ich werde ihn daher noch nicht übergeben.“
Von der plötzlichen Ehrlichkeit überrascht zuckte es im Gesicht des Präsidenten und er lehnte sich in seinem Stuhl zurück.
„Ich weise sie noch einmal an ihren Bruder den Erdbehörden zu übergeben.“
„Wir brauchen nur noch wenige Stunden, um die Waffe zu finden…“
„Sofort.“
Abermals dachte Captain Lewinski darüber nach, was er nun tun sollte. Liefen heute alle Befehle darauf hinaus sich die eigenen Leute zum Feind zu machen? Musste er etwa alles riskieren, um schlussendlich die Erde zu retten?
„Sir, ich werde meinen Bruder nicht übergeben, da er unsere einzige Chance ist die Waffe zu finden.“
„Sie haben dreißig Minuten“, erklärte der Präsident und beendete die Verbindung. Scheinbar hatte er noch Hoffnung, dass es sich John anders überlegen würde. Doch dieser hatte seine Entscheidung getroffen. Entsetzt blickte er zu seiner Brückenbesatzung. Diese war bereit ihm bedingungslos zu folgen, weil sie fest davon überzeugt waren das richtige zu tun. Hoffentlich war dies auch so.
Das Element der Überraschung war verflogen, dies wurde Jozarnay Woil klar, als die Alarmsirenen des Gebäudes laut losheulten. Offenbar hatte man seinen Ausbruch bemerkt und würde nun Maßnahmen einleiten, um ihn wieder einzufangen. Der Antosianer hatte keinerlei Ahnung, wie viel Zeit inzwischen vergangen war. Vielleicht eine Viertelstunde, möglicherweise auch drei Stunden, Jozarnay hatte absolut keine Ahnung. Seit seiner Gefangennahme hatte Woil jegliches Zeitgefühl verloren. Eigentlich interessierte es ihn auch gar nicht. Dinge wie Minuten, Stunden oder Jahre spielten keine Rolle mehr in seinem Leben. Alles, was ihn interessierte war Stella und diese Person war endlich wieder da. Viel zu sehr hatte er die Frau vermisst. Dass sie ihn Wirklichkeit tot war spielte für ihn keine Rolle.
Ihre Anwesenheit allein zählte. Immer wieder, wenn Jozarnay an Kreuzungen oder Türen vorbei kam, stand Stella dort und wies ihm den richtigen Weg. Ohne ihre Hilfe wüsste er nicht, wohin er gehen sollte. Weder kannte er die Ausmaße seines Gefängnisses noch wo sein momentaner Standort war. Er musste sich einfach darauf verlassen, wohin ihn seine Liebste führte und wieso sollte sie ihm den falschen Weg weisen?
Leider war sie bei der ganzen Hilfe jedoch nicht in der Lage gewesen den Alarm zu verhindern. Sofort zog sich Woil in eine dunkle Ecke zurück und lauschte den Geräuschen, die im Anschluss an die Sirenen folgten. Deutlich hörte man Schritte sowie einige aufgeregte Stimmen. Scheinbar war sein genauer Aufenthaltsort nicht bekannt, denn ansonsten hätte man ihn schon längst überwältigt. Auch mussten die technischen Möglichkeiten dieses Ortes äußerst begrenzt sein, denn sonst hätten sie den Ausbrecher schon längst wieder in eine Zelle gebeamt. Diesen Umstand konnte er zu seinem Vorteil nutzen, bedeutete es doch, dass sie Woil auf die gute, alte Art und Weise aufspüren mussten!
Doch noch immer galt es eine Hürde zu nehmen: sein Körper zitterte noch immer vom Drogenentzug. Nachdem er sich nun in (zeitweiser) Freiheit befand wuchs sein Verlangen nach White stetig. Es galt also den Ort zu finden, wo seine Wärter die Drogen aufbewahrten. Zu dumm, dass er absolut keine Ahnung hatte, wo sich dieser befinden könnte.
„Du zweifelst?“ fragte auf einmal eine vertraute Stimme und für den Bruchteil einer Sekunde erschrak der Antosianer darüber, wie nah sie doch war. Es handelte sich um Stella Tanner, die neben ihm in der Ecke stand.
„Ich weiß es nicht“, gab der Ausbrecher offen und ehrlich zu. „Mir geht es nicht so gut.“
„Du brauchst das White, nicht wahr?“ flüsterte die hübsche Frau und lugte kurz um die Ecke, vergewisserte sich nicht entdeckt worden zu sein.
Als Antwort nickte der ehemalige Chief nur.
„Keine Sorge, ich werde dich dorthin führen. Es ist ohnehin nicht mehr weit. Du musst nur aufpassen nicht entdeckt zu werden.“
Die Worte klangen wie Musik in den Ohren des Antosianers. Nicht nur schien sich Stella also tatsächlich in diesem Gebäude auszukennen, sie schien auch genau zu wissen, was er nun brauchte. Gab es ein offenkundigeres Zeichen dafür, dass sie ihn liebte?
Die traute Zweisamkeit wurde unterbrochen, als eine Person um die Ecke trat. Es war einer seiner Häscher, der scheinbar gedankenlos in die Ecke gestolpert war. Scheinbar war er nicht auf der Suche nach dem Ausbrecher gewesen, denn er schien genauso überrascht über den Anblick zu sein wie Woil selbst. Der Antosianer zögerte keine Sekunde, packte den Gegenüber am Kopf und schlug diesen gegen die harte Steinwand. Deutlich war das Knacken der brechenden Nase zu hören und bewusstlos ging der Mensch zu Boden. Schnell versteckte Jozarnay den Reglosen in der Ecke und machte sich, geleitet von Stella, auf den Weg. Diese Person würde schon bald von seinen Komplizen vermisst werden und Woil wollte nicht zugegen sein, wenn dessen Verstärkung eintraf. Er brauchte keine Angst haben, denn Stella Tanner war an seiner Seite. Alles würde gut werden!
Endlich hatten sie das Ziel ihrer Fahrt erreicht. Für Danny hatte die Fahrt viel zu lange gedauert. In jeder einzelnen Sekunde war es ihm schwer gefallen sich auf die Straße zu konzentrieren und nicht über das nachzudenken, was er getan hatte, was jedoch schier unmöglich gewesen war. Immer und immer wieder hatte er das Bild Nelsons vor Augen, im Angesicht seines Todes, als Danny den Abzug seiner Waffe betätigt und damit das Leben des Mannes beendet hatte. Der Umstand, dass sie nun beim Haus seiner Witwe angekommen waren, machte die Sache ganz sicher nicht leichter. Das ganze Leben schien wie in Zeitlupe an ihm vorbei zuziehen, als die beiden Männer aus dem Hoverwagen stiegen und sich der Tür des schmucken Hauses näherten. Die Szenerie wirkte auf Bird unheimlich, erinnerte ihn an die Holofilme über vergangene Kriege der Erde, als Priester und andere Offizielle die Hinterbliebenen der Gefallenen aufsuchten, um ihnen die tragische Nachricht zu überbringen. Nichts anderes taten James und er nun. Doch wie viele dieser Boten waren schon selbst für den Tod jener Person verantwortlich?
„Bereit?“ fragte James Talley überflüssigerweise und knöpfte sein Jackett zu.
„Kann man das denn sein?“ war die entsprechende Gegenfrage Birds.
Statt das Gespräch weiter zu vertiefen betätigte der Untergrundchef die Türklingel und es dauerte nicht lange, bis Martha Nelson die Tür öffnete. Der gegenwärtigen Tageszeit entsprechend war sie noch in ein Nachthemd gekleidet, über das sie einen Morgenmantel trug.
„James“, begrüßte Martha den Besucher und umarmte ihn überschwänglich, bevor sie Danny die Hand gab und beide in ihr Haus bat. Jene warmherzige Begrüßung war keine Überraschung, denn Talleys kümmerte sich um die Familien seiner Untergebenen. Das private Glück war ihm wichtig, beeinflusste es doch auf vielfältige Art und Weise die Moral seiner Mitarbeiter. Danny und er wurden gebeten auf einem unglaublich bequemen Sofa Platz zu nehmen und Martha Nelson verschwand in der Küche, um ihren Besuchern etwas Kaffee zu bringen. Eine willkommene Gelegenheit für Danny, um den Versuch zu starten sich von den unangenehmen Gedanken abzulenken und so ließ er seinen Blick durch das große Wohnzimmer streifen. Es war geschmackvoll eingerichtet, mit den neuesten Möbeln und Blumen in fast jedem Winkel des Raumes. Die Wände wurden gesäumt von kunstvollen Malereien längst vergangener Epochen. Dazwischen, fast schon unmerklich, befanden sich Fotografien der Familie. Josh Nelson, seine Frau sowie seine beiden Kinder waren auf den meisten von ihnen zu sehen. Dort wirkte die Familie Nelson wie eine normale Vorstadtfamilie, die einer geregelten Arbeit nachging und mehr als glücklich war. Leider war dies nur eine Fassade, denn zumindest Martha wusste von der Arbeit ihres Mannes. Mehr als einmal hatte der Lieutenant sie auf dem Anwesen Talleys gesehen und sogar mit ihnen über Politik debattiert. Ob die beiden jugendlichen Kinder jedoch von den Machenschaften ihres Vaters wussten, war ihm nicht bekannt. Schmerzlich wurde Danny bewusst, dass er Waisen geschaffen hatte.
„So, da ist der Kaffee, “ meinte Martha lächelnd und stellte zwei dampfende Tassen vor ihren beiden Gästen ab.
„Sehr freundlich von dir“, bedankte sich James und genoss das Aroma des braunen Getränkes. „Magst du keinen nehmen?“
„Nein, ich habe heute schon genug davon genommen“, winkte die Frau ab und lächelte.
„Du bist schon länger wach?“
„Ja, irgendwie konnte ich nicht so lange schlafen heute. Aber egal! Sag mir, James, was ist der Grund deines Besuches bei mir?“
Danny blickte zu James, der ihn jedoch scheinbar ignorierte und selbst kurz zu Boden blickte, Er schien sich seine Worte zurechtlegen zu wollen und der Sicherheitschef der Monitor fragte sich instinktiv, was der Anführer wohl der Witwe sagen würde. Doch nicht etwa die Wahrheit? Die Konsequenzen, wenn sie erführe, dass Danny Bird ihre Mann getötet hatte, wären unvorstellbar. Ein Hauch von Übelkeit stieg in dem jungen Mann auf und nur mit aller Mühe konnte er ein Zittern unterdrücken.
„Martha, ich muss dir etwas Wichtiges sagen, “ begann James und versuchte einen ruhigen Tonfall anzuschlagen.
„Was meinst du? Ist etwas mit Josh?“
Sofort hatte die Ehefrau die veränderte Stimmung erfasst und verstanden, dass es sich hierbei nicht um einen einfachen Höflichkeitsbesuch handelte. Viel mehr handelte es sich um einen äußerst ernsten Besuch.
„Es tut mir sehr Leid…. Josh ist tot.“
Die Worte, obwohl mit Bedacht und Ruhe ausgesprochen, wirkten dennoch wie ein Faustschlag auf die Frau, die eben zur Witwe geworden war. Schockiert vergrub sie ihr Gesicht in ihren Händen und begann zu schluchzen. Doch statt lauthals loszuheulen schluchzte und seufzte sie nur weiterhin, bis sie schließlich aufblickte.
„Wieso ist mein Mann tot?“
Die verständlichste Frage der Welt und zum ersten Mal, seit sie sich hingesetzt hatten, blickte James zu seinem Begleiter. Überrascht weitete dieser seine Augen und hoffte, dass dies nicht sein Ernst war. Danny sollte nicht tatsächlich etwas zu seinem Tod sagen!
„Deswegen habe ich Danny mitgebracht. Er kann dir mehr zum Tod deines Mannes sagen.“
Und Martha blickte ihn mit einer Erwartungshaltung an, die sein Herz in tausend Stücke zerspringen ließ. Sie erhoffte sich Antworten von ihm, die er ihr niemals geben konnte.
Bird hatte keinerlei Ahnung, was James nun von ihm verlangte. Er nahm doch nicht tatsächlich an, dass er ihr die Wahrheit oder zumindest die fingierte Wahrheit erzählen würde, die zum Tod Josh Nelsons geführt hatte.
„Möglicherweise weißt du es nicht, “ begann Danny und sprach dabei sehr langsam, weil er Angst hatte unter der Last der Wahrheit zusammenzubrechen, „aber wir arbeiten derzeit an einer großen Sache. Eine sehr große Sache, wie ich hinzufügen muss. Bitte versteh, dass weder ich noch James dir davon erzählen können und auch dein Mann musste Stillschweigen darüber bewahren. Diese ganze Angelegenheit war uns allen sehr wichtig gewesen.
Die gesamte Organisation war an der Planung beteiligt gewesen… und dein Mann gab sein Leben dafür, um diese Idee zu schützen.“
„Wie meinst du das?“
Kurz atmete Danny tief durch, um die Lüge vorzubereiten, die er nun fortführen wollte.
Ob sie seinen Worten Glauben schenkte? Zumindest hoffte er dies.
„Die Behörden waren uns und unserer Operation auf die Schliche gekommen“, log der Lieutenant und hasste sich dafür dies zu tun. „Sie beschatteten Josh schon eine ganze Weile über und planten ihn festzunehmen. Dein Mann wusste dies. Ihm war klar, dass sie ihn bei einer Festnahme irgendwann unser Geheimnis entlocken würden… und so gab er das höchste Opfer. Heute Morgen fand ich ihn mit aufgeschlitzten Pulsadern.“
Martha nickte, als sie die scheinbare Wahrheit verstand. In ihren Augen war dieser Selbstmord ein ehrenwerter Tod. Ihr Liebster hatte sein Leben für die Sache der Befreiungsarmee gegeben. Als er den Ausdruck in ihren Augen sah, wurde Danny instinktiv klar, dass auch sie über die Pläne zur Zerstörung der Erde bescheid wusste. So unschuldig, wie viele Familienmitglieder des Führungszirkels taten, waren sie nicht.
„Vielen Dank für deine Offenheit“, erklärte die frischgebackene Witwe und schien ihre Worte tatsächlich ernst zu meinen. Wo war der sechste Sinn, den Mütter und Frauen angeblich besaßen? Spürte sie denn nicht die Schuld, die auf Danny lastete für das, was er getan hatte? Sicherlich war Josh Nelson ein Krimineller gewesen, der ihm in den letzten Monaten das Leben schwer gemacht hatte, doch ein solches Ende hätte er sich für niemanden gewünscht.
„Wir können verstehen, wenn du nun etwas allein sein möchtest“, erklärte James mit ungemein ruhiger, fast schon melodischer Stimme. „Falls du etwas brauchst, dann lass es mich wissen. Mach dir keine Sorgen um finanzielle Dinge und dergleichen. Ich werde für alles aufkommen. Josh war ein Freund von mir gewesen und wir werden ihn würdig zu Grabe tragen.“
Betreten nickte die Witwe und der Anführer der Föderalen Befreiungsarmee drückte ein letztes Mal ihre Hand, bevor Danny und er das Haus verließen. Langsam schlenderten sie zu dem Hoverwagen.
„Das hast du gut gemacht“, lobte James ihn und öffnete seine Wagentür.
Angesichts dieser Worte stoppte Danny und blickte zu seinem Gegenüber.
„Ist das zynisch gemeint?“
„Nein, völlig ernst.“
„Mir kam es jedoch so vor! Was sollte die ganze Sache? Erst musste ich Nelson für dich töten und nun seiner Frau etwas vorlügen. Ich dachte er wäre dein Freund gewesen?“
Zorn funkelte in Birds Augen und nur mit Mühe konnte er verhindern lauthals loszuschreien. Die ganze Sache nahm langsam Überhand, belastete ihn stark.
„Josh war mein Freund gewesen und er hat mich verraten. Er hat seine gerechte Strafe erhalten. Dennoch vergesse ich niemals, was man für mich getan hat und so werde ich seiner Familie beistehen. Die Sünden des Vaters sollen nicht den Kindern zur Last werden.“
„Trotzdem wollte ich nicht deine Drecksarbeit erledigen!“
„Hör mal zu“, fauchte James zurück und seine Stimme gewann allmählich an Schärfe. „Ich habe dir vieles durchgehen lassen und dich Schritt für Schritt in meine Organisation eingeführt. So gut es geht habe ich versucht dir nicht die hässliche Seite der ganzen Sache zu zeigen, doch dies konnte nicht ewig so weitergehen. Früher oder später musstest auch du der Wahrheit ins Gesicht sehen. Diese Aufgabe bringt Opfer mit sich… manchmal auch große!“
Zornig blickte Danny den dunklen Mann an und überlegte sich, ob er noch etwas sagen sollte. Dann jedoch entschied er sich dagegen und begann den Antrieb des Wagens zu starten.
Nur Sekunden später setzte sich auch James Talley in den Wagen.
„Mein erstes Mal war auch nicht leicht gewesen“, flüsterte der Kriminelle und schwieg dann.
Seit dem Beginn des Ultimatums hatte Captain Lewinski seinen Bereitschaftsraum nicht mehr verlassen. Er hatte sich in diesen Bereich zurückgezogen, um über alles nachzudenken. Bis zu seiner Rückkehr und der Verkündung einer Entscheidung arbeitete die Crew der Monitor weiter wie bisher, versuchten mit den Spezifikationen Martins die Waffe zu finden. Price stand im hinteren Bereich der Brücke und beobachtete den Neuankömmling an Bord, der sich immer mal wieder über den sitzenden Ardev beugte, um dessen Ergebnisse zu begutachten.
„Er macht ihnen Sorgen, oder?“ fragte Arena Tellom, die sich, ohne dass der Halbbetazoid es gemerkt hatte, neben ihn gestellt hatte.
Ohne den Blick von dem Waffenhändler zu nehmen entgegnete dieser:
„Sollte er das etwa nicht? Wir haben es hier mit einem Menschen zu tun, der seinen Profit damit verdient Waffen zu verkaufen und dabei sogar Massenvernichtungsmittel an den Mann bringt. Ich traue ihm keinen Schritt über den Weg.“
Angesichts dieser Worte nickte Lieutenant Tellom und signalisierte so stumm ihre Zustimmung. Dass dieser Kriminelle so eng mit ihrem Mann zusammenarbeitete gefiel ihr ganz und gar nicht. Obwohl es derzeit nicht so aussah, als wäre Martin Lewinski zu irgendwelchen Gewalttaten bereit, so machte sie sich dennoch Gedanken darüber.
„Seltsam, wie dieser Mann das genaue Gegenteil seines Bruders sein kann“, murmelte Arena und sprach damit genau die Gedanken aus, die auch Matthew durch den Kopf gingen. „Der eine ist ein Sternenflottenoffizier aus dem Buche, der alles tut, um die Föderation zu schützen und der andere ist ein Krimineller, der nur an den eigenen Profit denkt.“
„Was mag wohl der Auslöser gewesen sein, dass sich diese beiden Persönlichkeiten so auseinander entwickelt haben?“ fragte Matt.
„Vielleicht kann er nicht anders… ein Opfer seiner Gene.“
Energisch schüttelte der Commander den Kopf.
„An so etwas glaube ich nicht“, erklärte Matthew. „Ich denke jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Martin hatte die Gelegenheit ein ähnliches Leben zu führen wie sein Bruder, doch er entschied sich anders. Zu dumm, dass er keine Reue zeigt.“
Statt einer Antwort nickte Arena nur und blickte den Gefangenen weiterhin an. Wie würde sich der Captain entscheiden? In wenigen Minuten lief das Ultimatum des Präsidenten ab und spätestens dann musste eine Entscheidung getroffen werden.
Aus diesem Grund betrat auch Fähnrich Kensington den Bereitschaftsraum des Captains. Wie sie es erwartet hatte stand John Lewinski mit hinter dem Rücken verschränkten Armen vor dem kleinen Sichtfenster seines Raumes, wie er es so oft tat, wenn ihm schwierige Gedanken durch den Kopf gingen. Er zeigte keine Regung, als sie den Raum betreten hatte.
„Sir“, versuchte sie ihn vorsichtig aus seiner Trance zu erwecken, „ich wollte sie nur informieren, dass die 30 Minuten bald um sind und der Präsident dann eine Entscheidung erwartet.“
„Ich weiß“, war die einzige Antwort des Captains.
Fähnrich Kensington wartete noch einige Sekunden und machte im Anschluss Anstalten den Raum wieder zu verlassen. Es waren jedoch einige unerwartete Worte, die sie inne halten ließen.
„Ob wir einen Fehler gemacht haben?“ fragte Captain Lewinski und zuerst fragte sich der taktische Offizier, ob diese Frage an sie gerichtet war.
„Sir?“
Endlich drehte sich der Kommandant um und blickte die junge Frau an. In seinem Gesicht konnte man deutlich die Last der Entscheidung erkennen, die nun auf ihm lastete.
„Noch vor einer Stunde schien es uns, als wäre es die einzig richtige Entscheidung Martin gewaltsam aus dem Gefängnis zu holen. Jetzt müssen wir uns den traurigen Konsequenzen stellen. Ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen.“
Nun verstand Samira Kensington, was das Problem an der Sache war. Doch aus irgendeinem nicht näher definierten Grund war sie nicht in der Lage eine adäquate Antwort von sich zu geben.
„Sie sollten keine Schuldgefühle deswegen haben!“ Diese Aussage schien dem Fähnrich am Geeignetsten zu sein. „Es war ein tragischer Unfall, für den wir nichts können.“
„Wir können was dafür… ohne uns wäre dieser Petty Officer noch am Leben. Berührt sie dies nicht?“
Lewinski war nun ganz nahe an sie herangetreten und versuchte in ihren Augen eine Reaktion zu finden, die er jedoch nicht fand.
„Es war den Preis wert gewesen. Ohne ihren Bruder hätten wir keine Chance die Waffe zu finden und immer noch stehen Milliarden Leben auf dem Spiel.“
„So einfach ist dies für sie?“
„Manchmal sollte man es sich nicht zu schwer machen“, entgegnete Fähnrich Kensington mit einer Kühle, die den Kommandanten der Monitor erschütterte.
„Und wenn sie diejenige gewesen sind, die den tödlichen Schuss abgefeuert hat?“
Doch statt zu antworten schwieg Samira und blickte ihren Captain an. Aus ihrer Perspektive war die gesamte Diskussion sinnlos und es gab auch keine Zeit hierfür. Einige Sekunden lang herrschte Stille, dann begab sich Captain Lewinski auf die Brücke, um sich erneut dem Präsidenten zu stellen. Das Ultimatum war abgelaufen.
Im Hintergrund arbeitete immer noch Martin Lewinski scheinbar friedlich mit Ardev zusammen, analysierte die gewonnenen Sensordaten und schien sich in der Tat Mühe zu geben ihnen zum Ziel zu helfen. Für einige wenige Momente schien das Lewinski-Gen bei dem Kriminellen aufzublitzen, was ihn wohl veranlasste sein bestes gegeben. Für einen kurzen Moment hielt John inne und beobachtete die Szenerie. Jahrelang hatte er seinen Bruder nicht mehr gesehen, absolut keinen Kontakt zu ihm gehabt. Dann war dieser wie aus dem Nichts wieder aufgetaucht und hatte sein Leben durcheinander gewirbelt. Auch wenn er Fehler gemacht hatte, Martin war immer noch sein Bruder und John liebte ihn. Allein aus diesem Grund wollte er ihn jetzt, so irrational dies auch klingen mochte, nicht gehen lassen.
John konnte nur hoffen, dass die gesamte Situation nicht eskalierte.
„Bericht!“ forderte er und setzte sich auf den Kommandantenstuhl.
„Wir sind immer noch beim Scannen“, erklärte Ardev und blickte nicht einmal von seinem Bildschirm auf. Derzeit schien er sich nicht aus der Konzentration bringen lassen zu wollen.
„Einen Großteil der Daten haben wir schon, der Computer muss sie jedoch noch auswerten“, ergänzte der jüngere Lewinski-Bruder.
Zu einer Erwiderung kam John gar nicht mehr, denn schon im nächsten Moment erschien das Gesicht des Präsidenten auf dem Wandschirm. Er hatte sich einfach durchschalten lassen, um nicht Gefahr zu laufen abgeblickt zu werden.
„Captain Lewinski, ich begrüße sie abermals“, meinte das Staatsoberhaupt und versuchte dabei seine Stimme so besonnen wie möglich klingen zu lassen. „Das Ultimatum von dreißig Minuten ist soeben abgelaufen. Ich erwarte die Übergabe von Martin Lewinski an die örtlichen Behörden.“
Alles in John wollte den Kopf wieder in Richtung hinteren Bereich der Brücke drehen, um den Blickkontakt zu seinem Bruder zu suchen und eine Reaktion in ihm zu erblicken. Doch dies hätte man als Zeichen der Schwäche deuten können, ein Eindruck, den John unbedingt vermeiden wollten. Daher hielt er dem fordernden Blick des Präsidenten weiterhin stand und erklärte mit fester Stimme:
„Mr. President, ich verweigere ihren Befehl meinen Bruder auszuliefern. Noch haben wir nicht alle Daten gesammelt, die wir benötigen um die Waffe zu finden. Wir brauchen noch einige Minuten.“
Alle auf der Brücke konzentrierten ihre gesamte Aufmerksamkeit auf das Gespräch zwischen beiden Männern. Noch vertrauten alle darauf, dass ihr Captain das richtige tat. Doch wie weit war er noch bereit zu gehen, um die Gefahr für die Erde abzuwenden? Sie alle bewegten sich auf dünnem Eis, dies war jedem klar.
„Übergeben sie ihren Bruder. Auf der Stelle!“ verlangte der Präsident und seine Tonlage machte deutlich, dass er diesen Befehl nicht noch einmal wiederholen würde.
„Nein.“
Irritiert und entsetzt lehnte sich der Präsident in seinem Sessel zurück und schien für einen kurzen Moment zu überlegen, ob Captain Lewinski bluffte. Ob dieser Mann tatsächlich bereit war gegen den Präsidenten der Vereinten Föderation der Planeten zu meutern. Er schien dies in der Tat durchziehen zu wollen. Ohne ein weiteres Wort beendete der Präsident die Verbindung, blickte noch eine weitere Minute auf den schwarzen Bildschirm und wendete sich dann Commander Kranick zu, die hinter ihm stand.
„Ich möchte, dass die Monitor auf der Stelle aufgebracht und Captain Lewinski verhaftet wird.“
Mit diesem Befehl hatte die Verbindungsfrau schon gerechnet.
„Dazu müssen wir erst einmal das Schiff finden, welches noch getarnt ist.“
„Wie lange wird dies dauern?“
„Wir können per externen Befehl die Tarnvorrichtung deaktivieren lassen. Dazu muss ich mir die benötigten Codes vom Geheimdienstoberkommando holen, “ erklärte der Commander.
„Beeilen sie sich!“ wies der Präsident sie an. „Und ich möchte mit Mr. Jellico sprechen.“
Ohne weitere Zeit zu verlieren verließ Commander Kranick das Büro und wollte ihrem Auftrag nachkommen. Nun galt es keine Zeit mehr zu verlieren.
Auch auf der Brücke des Geheimdienstschiffes herrschte gespannte Atemlosigkeit. Zwar hatte dieser Tag schon einiges an Überraschungen bereitgehalten, dennoch hatte wohl niemand mit dieser Eskalation gerechnet.
„Wer nicht mit meiner Vorgehensweise einverstanden ist“, erklärte Captain Lewinski, als er sich an seine Crew wandte, „dem steht es frei von seinem Posten zurück zu treten.“
Seltsamerweise wollte niemand sich melden. Taten sie dies nur Angst oder vertrauten sie ihm wirklich? Nur die Zeit würde dies wohl zeigen.
„Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest!“
Das Vertrauen von Jozarnay Woil in seine imaginäre Begleiterin war nicht enttäuscht worden. Sicher hatte Stella Tanner ihn an den Wachen vorbei durch den Perimeter geschleust und ihn fast zu dem Ketracel-White gebracht, welches er inzwischen so dringend benötigte. Möglicherweise lag es an dem Adrenalin, dass er mehr noch als zuvor nach dem synthetischen Stoff dürstete. Nur noch ein einziges Schott sowie einige Wachen trennten ihn von der rettenden Injektion.
Abwartend und überlegend stand Woil in einer Ecke und lugte in den Gang hinein, in dem er drei Wachen sah. Sie schienen ihn nicht bemerkt zu haben und trotz der erhöhten Sicherheitsstufe wirkten sie seltsam unkonzentriert.
„Es wirkt fast wie eine Falle“, murmelte Woil, mehr zu sich selbst denn zu jemand anderem.
Und da war sie wieder. Aus dem Nichts war Stella erschienen, stand direkt neben ihm. Deutlich spürte der Antosianer ihre Körperwärme, konnte ihr dezentes Parfum riechen. Alles in ihm strebte danach sie zu küssen, ihr durch das rote Haar zu fahren und die Zeit zu vergessen. Doch dies war nicht der geeignete Moment für solche Zärtlichkeiten. Sicher, ein solcher würde noch kommen und dafür lohnte es sich durchzuhalten. Derzeit jedoch musste sich Woil auf wichtigeres konzentrieren.
„Zweifelst du?“ fragte Stella und bemühte sich leise zu sprechen.
Angesichts dieser Frage musste der ehemalige Chief zynisch grinsen.
„Na ja, in dem Gang stehen drei bewaffnete Wachen, die mich wahrscheinlich erwarten. Ergo sind sie, wenn du richtig rechnest, mir drei zu eins überlegen.“
Zärtlich streichelte seine Liebste sein Gesicht und blickte Jozarnay tief in die neongelben Augen. Mitgenommen sah er aus, unrasiert und schmutzig.
„Du gibst doch nicht etwa auf?“ fragte sie keck und lächelte ihn an. „Dies wäre nicht der Jozarnay Woil, den ich kennen gelernt habe… und den ich liebe.“
Die Worte verfehlten nicht ihren Sinn. Sie motivierten ihn aufs Neue, stärkten etwas in ihm, welches ihn zu größeren Taten anspornte. Sanft nahm er ihre Hand, küsste sie sanft und prüfte dann die Einstellung auf seinem Phaser. Sie war, wie er es schon erwartet hatte, auf Töten gestellt. Es machte keinen Sinn seine Gegner zu betäuben. Wie sollte er, ohnehin schon zahlenmäßig deutlich unterlegen, jemals fliehen, wenn seine Widersacher immer wieder zu sich kommen würden? Zudem wollte er, tief in seinem Innersten, seinen Peinigern wehtun. Etwas in ihm wollte sie töten. Früher waren dies Gedanken, die ihn zutiefst erschreckt und angewidert hätten. Jedoch waren diese Zeiten längst vorbei. Jozarnay war einen langen Weg gegangen und hatte sich verändert. Alles war anders geworden.
Ein letztes Mal blickte der ehemalige Chefingenieur in die grünen Augen seiner Liebsten, dann wirbelte er um die Ecke und hoffte den Überraschungsmoment gewinnbringend nutzen zu können. Die erste Wache schoss er sofort nieder. Sie hatte nicht einmal mehr die Gelegenheit zu schreien, als sie vom Phaserimpuls in den Rücken getroffen wurde und starb. Die beiden anderen Männer waren anscheinend zu verdattert, dass der Ausbrecher ausgerechnet hier auftauchte und reagierten für den Bruchteil einer Sekunde zu spät. Gerade genug, um Woil den entscheidenden Moment Vorsprung zu geben. Mit einem Schrei auf den Lippen rammte er seine Schulter gegen den Körper des einen Mannes, drängte ihn so in den Raum hinein. Sofort wirbelte Jozarnay herum, richtete die Waffe grob auf den dritten Wachmann und drückte ab. Es war ein ungezielter Schuss, doch zu seinem Glück war auch dieser ein Volltreffer. Mit grimmiger Befriedigung konnte Woil, der selber durch den Schwung in den Lagerraum flog, mit ansehen, wie der Getroffene durch die Wucht von den Füßen gerissen wurde und ebenfalls starb. Doch für Siegesfreude war keine Zeit.
Der Antosianer verlor keine Zeit, schoss auf die Schottkontrollen und die Türen zu dem Lagerraum schlossen sich automatisch. Nun befanden sich nur noch er sowie die Wache hier drin. Zwar waren die Sicherheitssysteme dieses Ortes veraltet, dennoch waren sie wohl mühelos in der Lage gewesen das Phaserfeuer zu registrieren, was bedeutete, dass bald noch mehr Wachen auf dem Weg hierher sein würden. Doch darum konnte er sich gleich kümmern. In einer fließenden Bewegung brachte Woil die Waffe auf den am Boden liegenden Wachmann in Anschlag.
„Nicht bewegen!“ brüllte er ihn an und überlegte für einen kurzen Moment, ob er nicht abdrücken sollte.
Doch zu seiner Überraschung tat er es nicht. Er beobachtete den jungen Mann, der vor ihm lag, die Hände in die Höhe gestreckt und ihn erwartungsvoll anblickte.
„Wenn du nur einmal zuckst, dann…“ drohte Jozarnay, erntete jedoch nur ein Kopfschütteln seines Gefangenen.
„Die Verstärkung ist schon auf dem Weg. Du hast keine Chance!“ feixte die am Boden liegende Person und schien sich in der Tat zu freuen.
„Schnauze!“ schrie Woil noch einmal und tatsächlich hielt der Gefangene seine Klappe.
Eine Geiselnahme war eigentlich nicht das gewesen, was er beabsichtigt hatte. Die ganze Situation hatte sich spontan entwickelt, ohne dass er sie so recht geplant hatte. Nun ja, auch aus dieser Sache würde er schon herauskommen. Dabei würde ihm Stella sicherlich helfen, die nun wieder neben ihm stand und eine Hand zärtlich auf seine Schulter gelegt hatte.
Diese Geste drückte ganz deutlich aus, dass alles wieder gut werden würde und dies war letztendlich das Einzige, was zählte!
Jetzt, wo er sein Ziel erreicht hatte, begann Jozarnay die sich hinter ihm befindlichen Schränke und Kartons zu durchwühlen. Dabei nahm er keine Rücksicht auf Ordnung oder Lautlosigkeit, sondern riss einfach eine Verpackung nach der anderen auf. Immer auf der Suche nach der lebensrettenden Injektion, die ihn vor schlimmeren bewahren würde.
„Du suchst das White, nicht wahr?“ fragte seine Geisel, doch er ließ sich nicht von ihren Worten beeindrucken.
Endlich, nach scheinbar endlosem Suchen ( was letztendlich nur wenige Minuten gedauert hatte ) fand der Antosianer endlich eine Phiole mit der wertvollen weißen Substanz und einen Injektor. Schnell legte er das Gerät an seine Schlagader an und betätigte den Auslöser. Schon im nächsten Moment spürte Woil, wie eine Woge aus Erleichterung und Glücksseligkeit ihn durchströmte. Sein ganzer Körper entspannte sich und neue Hoffnung floss durch seine Venen. Augenblicklich war er in der Lage zu bemerken, wie sich seine Sinne schärften und er neue Kraft schöpfte. Das Zittern verschwand, ebenso die Hitzewallungen und wurde durch pure Freude ersetzt. Glücklich blickte Jozarnay in eine Ecke des Raumes und lächelte der dort stehenden Stella Tanner zu.
„Ich habe es gefunden“, lächelte er. „Dank dir!“
„Mit wem redest du da?“
Die verwirrte Frage seines Gefangenen war nur zu verständlich, schien doch aus seiner Perspektive der Antosianer mit der Wand zu reden. Was sollte es schon? Er war halt nicht in der Lage diese bezaubernde Frau zu sehen, die ihm mal wieder das Leben gerettet hatte.
„Dies geht dich gar nichts an“, entgegnete Woil und lächelte immer noch die Frau.
„Du bist wahnsinnig“, murmelte die Wache und schüttelte den Kopf, „ein Wahnsinniger!“
Als Antwort erntete er einen Schlag von dem Phaserkolben, der eine Platzwunde am Kopf hinterließ. Seine Aussage hatte Woil so sehr in Rage versetzt, dass er in einer Kurzschlussreaktion ihn einfach geschlagen hatte.
„Noch ein Wort…“ drohte der ehemalige Chief und ließ den Satz unvollendet.
Dann begann man von außen die Geräusche weiterer Personen zu vernehmen. Zweifelsohne handelte es sich um weitere Wachen, die anrückten, um ihren gefangenen Kollegen zu befreien. In Jozarnays Kopf raste es. Fieberhaft dachte er darüber nach, wie er sich aus dieser Lage befreien konnte. Genauso wie seine Geiselnahme war auch der Aufenthalt an diesem Ort eher spontan geschehen und erst jetzt, nachdem er seine Sucht gestillt hatte, wurde dem Antosianer bewusst, worin er sich hineinmanövriert hatte. Der Raum schien nur einen Ausgang zu besitzen, den er vor wenigen Minuten beseitigt hatte, und sonst keine anderen Möglichkeiten der Flucht.
„Hörst du das?“ fragte die Wache spöttisch. „Schon in wenigen Minuten werden sie hier drin sein und dich wieder in eine Zelle werfen. Eine, aus der du nicht so leicht wieder fliehen wirst!“
„Wie komme ich hier heraus?“ fragte Woil mit grollender Stimme und erste Schweißperlen rannten ihm von der Stirn. Von draußen hörte man Geräusche an der Tür, die auf einen Laserbrenner oder Ähnliches schließen ließen. Man begann bereits sich durch die Tür zu arbeiten.
Doch statt eine Antwort von sich zu geben schwieg die Wache und so wusste sich Jozarnay nicht anders zu helfen, als die Geisel zu schlagen
„Wie komme ich hier heraus? Antworte oder du bist tot!“
Und wie um seine Drohung zu verstärken legte er die Waffe auf die am Boden liegende Person an.
„Du hast keine Chance. Selbst wenn du fliehst, “ drohte die Wache, „Edward Jellico wird dich finden und wieder einsperren… falls du Glück hast und er nichts schlimmeres mit dir anstellt.“
Angesichts dieser Situation schlug das Herz des Antosianers immer heftiger. Was sollte er nur tun? Schon in wenigen Minuten würden die restlichen Wachen hier drin sein und es schien keinen Ausweg zu geben. Das White floss zwar durch seine Venen, dennoch fühlte er sich wie benebelt. Immer noch hatte er den Phaser auf den Gefangenen gerichtet. Konnte er überhaupt abdrücken und so seine Drohung in die Tat umsetzen? War er in der Lage eine andere Person zu ermorden? Bisher hatte er immer in Notwehr getötet, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Nun jedoch dachte er ernsthaft darüber nach einen derzeit wehrlosen Menschen zu erschießen. War es etwa schon so weit gekommen und was war aus dem einstigen Sternenflottenunteroffizier Jozarnay Woil geworden?
Deutlich konnte sich der Antosianer daran erinnern, wie er schon einmal hatte morden sollen und es dann doch nicht getan hatte. Damals, als er Edward Jellico Auge in Auge gegenüber gestanden hatte:
Angesichts der Ereignisse im letzten Jahr hätte er vorsichtiger sein müssen. Er selbst hatte sich geschworen, dass niemand mehr so leicht an ihn herankommen und ihm gefährlich werden konnte. Doch ein jeder wurde alt und dies darf wohl auch im weitesten Sinne auf Edward Jellico zu. Natürlich war er immer noch ein Verschwörer und Intrigant, doch sein politischer Posten im Justizministerium hatte ihn träger gemacht, als er es sich selbst eingestehen wollte. Die alte Wachsamkeit war durch Bequemlichkeit ersetzt worden.
Daher dürfte es auch niemanden überraschen, dass den ehemaligen Admiral der Sternenflotte im Turbolift eine Überraschung erwartete. Jellico wollte sich gerade auf dem Weg zu einer weiteren Besprechung machen. Wie so oft trug er einen teuren Anzug und in seiner linken Hand eine Aktentasche mit allen wichtigen Dokumenten, die er für eine solche Sitzung brauchte. Er war zufrieden mit sich selbst und der Arbeit. Immer tiefer wurde er ins Vertrauen gezogen, immer höher stieg er in der Gunst seiner Vorgesetzten. Aus dem ehemaligen Verräter, der beinahe für den Rest seines Lebens im Gefängnis gelandet wäre, war ein respektierter Mann geworden. Grund dafür waren die zahlreichen Erfolge gegen Sektion 31, die er vorweisen konnte. Beinahe schon war es zu einfach die alten Kollegen ans Messer der Justiz zu liefern. Wer weiß, vielleicht war irgendwann das Amt des Justizministers in greifbarer Nähe. Die öffentliche Meinung über ihn hatte sich gewandelt, Edward Jellico war beliebt und sicherlich ein guter Mandatsträger. Ein kleiner Ausgleich für den Tod seiner geliebten Familie, den er im letzten Jahr hatte hinnehmen müssen.
Doch als er gedankenverloren in den Lift einstieg und sich die Türen schlossen, wurde ihm seine Nachlässigkeit bewusst. Ein Phaser wurde auf seinen Kopf gerichtet, summend erwachte die tödliche Waffe zum Leben. Aus dieser Entfernung bestand kein Zweifel an der Tödlichkeit eines Treffers.
Langsam, ohne seinen Angreifer provozieren zu wollen, drehte sich Edward in die Richtung des Schützen und hob amüsiert die Augenbrauen.
„Mr. Woil, es überrascht mich, sie zu sehen!“ meinte der alte Mann unerwartet
fröhlich. „Noch mehr überrascht mich, was sie hier mitgebracht haben.“
Der Antosianer erwiderte nichts, konzentrierte sich weiterhin darauf die Waffe auf den Kopf seines Feindes zu richten. Keine leichte Aufgabe, denn Jozarnay war kotzübel und er musste sich alle Mühe geben nicht zu zittern.
„Nun sind sie also gekommen, um das Werk zu vollenden“, schwadronierte Edward Jellico weiter. „Haben sie keine Angst, dass sich schon im nächsten Moment die Türen dieses Turboliftes öffnen könnten?“
„Ich habe das System manipuliert. Ohne mich wird hier wieder jemand ein- noch aussteigen, “ entgegnete der ehemalige Chief endlich. Jedes einzelne Wort hatte ihn eine unbändige Kraft gekostet. Abermals perlte Schweiß von seiner Stirn, diesmal jedoch nicht hervorgerufen durch den Entzug, sondern die Angst.
„Ah, bei ihren Qualifikationen hätte ich mir dies auch selbst denken können. Dies erklärt auch, wie sie unbemerkt in das Ministerialgebäude haben eindringen können. Sehr clever von ihnen, wirklich. Nur denke ich nicht, dass das töten ebenfalls zu ihren Fähigkeiten gehört. Gehe ich recht in der Annahme, Mr. Woil?“
Die Worte des alten Mannes ließen ihn nur noch nervöser werden. Was war hier los? Während des ganzen Fluges hatte er sich die ganze Sache so leicht vorgestellt. Einfach hineingehen und abdrücken. Doch nun, kurz vor dem Ziel, versagten ihm die Hände ihren Dienst. Oder war etwas anderes der Grund dafür?
„Wie wäre es, wenn sie einfach die Schnauze halten?“ fauchte der Antosianer.
„Sie sind nervös, Chief. Ich darf sie doch so anreden, auch wenn sie die Sternenflotte schon lange verlassen haben. Deswegen müssen sie sich keine Sorgen machen. Das erste Mal ist immer etwas Heikles. Als ich meinen ersten Menschen ermordete, war ich auch mehr als verängstigt. Doch je öfter man es macht, desto leichter geht es von der Hand.“ Kurz zögerte Edward Jellico und zum ersten Mal seit Woil ihn kannte, zeigte sich so etwas wie Menschlichkeit in den Augen des alten Gegners. „Manchmal jedoch, in den ruhigen Momenten, kehren vor dem geistigen Auge die Gesichter der Toten wieder und holen einen heim. Daran kann man sich leider nicht gewöhnen. Sind sie bereit für diese Bürde, Mr. Woil?“
Der Angesprochene wünschte sich mit jeder Faser, dass der alte Mann endlich mit seinem Gequatsche aufhörte. Dabei hatte er das Mittel, ihn zum Schweigen zu bringen, in der Hand. Eine einzige Fingerbewegung und die Sache wäre erledigt gewesen. Schon zu lange befand er sich an diesem Ort, die Gefahr einer Entdeckung stieg kontinuierlich. Doch es ging nicht.
„Wieso machen sie die Drecksarbeit für diese Frau?“ fragte Jellico direkt. „Wieso tötet sie mich nicht selbst, wieso schickt sie jemand anderes? Und wieso tun sie es? Tun sie es für das White? Falls ja, ich kann ihnen auch mehr als genug davon liefern. Erinnern sie sich noch an das letzte Jahr, als ich ihnen eine Phiole schenkte? Unzählige warten noch auf sie, falls sie möchte. Was also ist es?“
Wieder schwieg Jozarnay. Immer mehr verkrampfte er und es fiel mehr als schwer die Fassung zu behalten. Die Worte des alten Mannes erzielten einen bestimmten Effekt bei ihm und dies war wohl beabsichtig.
„Sie lieben sie“, stellte Jellico schließlich mit zusammengekniffenen Augen fest, so als hätte er die Gedanken seines Gegenübers gelesen. „Ja, sie tun es, weil sie in Stella Tanner verliebt sind und sie denken felsenfest, dass die Frau diese Gefühle erwidert. Doch dem ist nicht so. Sie spielt nur ein Spiel mit ihnen, glauben sie es mir!“
Eigentlich waren diese Worte eine große Beleidigung für Jozarnay. Er kochte innerlich vor Wut, fluchte und raste. Doch der gute Mensch in ihm, der ehemalige Sternenflottler und alte Gläubige, gewann die Oberhand und fast schon panisch flüchtete er aus dem Turbolift. Vielleicht würde Edward Jellico schon im nächsten Moment die Wachen auf ihn hetzen oder sogar töten lassen, aber Woil musste hier weg.
Noch lange nach dieser Aktion schaute Jellico in den Gang hinaus, in den Woil entflohen war. Obwohl ihm sofort der Gedanke gekommen war, ließ er den Gedanken der Rache an dem Antosianer fallen. Der ehemalige Chief war nur eine Marionette, dies wusste er. Vielmehr war Tanner das Ziel. Und irgendwie hatte er das Gefühl, dass seine Rache nicht mehr allzu weit entfernt war.
Damals hatte er es nicht geschafft den Abzug zu betätigen. Retrospektiv war dies vielleicht die falsche Entscheidung gewesen. Hätte er Jellico getötet, so wäre Stella noch am Leben und er nicht in Gefangenschaft. Nachdenklich blickte Woil auf seinen Gefangenen, der ihn süffisant angrinste. Es war nur noch eine Frage von Sekunden, dann würde die Verstärkung in den Raum eingebrochen sein und ihn wieder festnehmen.
Was wohl geschähe, wenn Woil die Wache am Leben ließe, darüber konnte er nur spekulieren. Die Erinnerung an das Ereignis vor unbestimmter Zeit machten ihm jedoch deutlich, dass sich dieses Ereignis nicht wiederholen dürfte. Daher traf Woil seine Entscheidung und drückte ab.
Aus der Waffe löste sich der Energiestrahl und fuhr in die Brust seiner Geisel, verbrannte sie und seine inneren Organe. Deutlich konnte Woil sehen, wie das Leben aus dessen Augen entwich. Es war ein unheimlicher Anblick und nahm ihn mehr mit, als er gedacht hatte.
„Nun bist du gänzlich ein Mann“, meinte eine Stimme neben ihm. Es war Stella, die sich auf einmal wieder im Raum befand.
„Wieso?“ grummelte Woil entsetzt. „Weil ich einen Menschen getötet habe?“
„Weil du getan hast, was nötig gewesen ist und ich hätte ebenso gehandelt.“
Die Worte trösteten Jozarnay nicht wirklich. In Wahrheit hatte er seinen Gefangenen nur aus Frust getötet, weil er nicht mehr weitergewusst hatte. Der Lösung seines Problems hatte ihn dies immer noch nicht näher gebracht. Unerwartetherweise spürte der ehemalige Chief die zärtliche Hand seiner Liebe in seinem Nicken. Sie tröstete ihn mit dieser zärtlichen Geste und, mehr noch, bedeutete ihm so nach oben zu schauen. An der Decke befand sich eine Wartungsöffnung! Mit etwas Glück würde er durch sie von hier verschwinden können. Wieso hatte er nicht gleich daran gedacht? Doch zum Sinnieren blieb keine Zeit:
„Los, beeil dich!“ spornte ihn Stella an und verdrängte so alle Gedanken der Reue.
Als die Wachen schließlich den Raum stürmten war Jozarnay schon längst durch die Wartungsöffnung geflüchtet.
Stimmungstechnisch gesehen war die Rückfahrt noch schlimmer als die Hinfahrt zum Anwesen der Nelsons. Ohne ein Wort zu sprechen oder irgendeine andere Art von Reaktion zu zeigen fuhr Danny Bird auf altmodische Art und Weise den Hoverwagen zurück.
Dabei blickte er starr auf die vor ihm liegende Straße, schien sich scheinbar auf den geringen Verkehr zu konzentrieren. Jedoch war dies nur die halbe Wahrheit, denn in Wirklichkeit versuchte er einfach nur den neben ihm sitzenden James Talley zu ignorieren. Dieser blickte zu dem jungen Mitglied der Föderalen Befreiungsarmee und strebte an dessen Gefühle zu ergründen.
Ja, was er ihm heute Morgen aufgebürdet hatte war eine schreckliche Sache gewesen und James hätte sich gewünscht, dass es einen anderen Weg gegeben hätte. Doch nur so konnte er sich der Treue Dannys absolut sicher sein. Natürlich war Josh Nelson ein langjähriger Freund gewesen, den er sehr geschätzt hatte. Gemeinsam mit ihm hatte James diese Organisation aufgebaut, mit dem Ziel die Demokratie und politische Führung wieder in die Hände des Volkes zu legen. Die letzten Regierungen hatten die Verfassung des Völkerbundes pervertiert, die Macht dem Volke entrissen und für die eigenen Zwecke genutzt. So durfte es unter keinen Umständen weitergehen! Sie beide waren Männer mit Idealen und Visionen gewesen, die etwas hatten verändern wollen. Umso schlimmer, dass ausgerechnet dieser Josh Nelson nun sie verraten und den Plan fast an die Föderation weitergegeben hatte. Immer noch fragte sich Talley, wie er sich so in einem Menschen hatte täuschen können. War er etwa so leichtgläubig geworden? Woran auch immer es gelegen hatte, dies durfte sich auf keinen Fall wiederholen. Sie waren so kurz vor Erreichen ihres langjährigen Zieles und konnten sich absolut keine Fehler mehr ereignen. Am Ende des heutigen Tages würde sich die Welt für immer verändert haben.
Es galt nur noch die letzten Stunden durchzuhalten!
Angesichts des fast schon greifbaren Erfolgs und des Abschluss einer jahrelang geplanten Operation fragte sich James, ob er Danny noch mehr ins Vertrauen ziehen sollte, als er es heute schon getan hatte. Nach dem „Wegfall“ Nelsons wurde nun ein Platz im obersten Führungszirkel der Armee frei und schon seit längerem überlegte James, ob er nicht ein junges, frisches Mitglied aufnehmen sollte. Auch wenn er ihn erst drei Monate kannte, so hatte der schwarze Mensch schon ein unglaubliches Vertrauen zu Bird aufgebaut. Innerhalb dieser kurzen Zeit hatte Danny es geschafft sich einen Namen zu machen. Natürlich hatte James noch vor wenigen Stunden gezweifelt und sich gefragt, ob nicht vielleicht Danny der Verräter gewesen war, der Timo Gruber ans Messer der Sternenflotte geliefert hatte.
Doch tief in seinem Innersten war ihm klar gewesen, dass sein junger Zögling ihn nicht enttäuscht hatte.
Und genau aus diesen Gründen überlegte der Anführer der Föderalen Befreiungsarmee, ob er Bird nicht gänzlich in den heutigen Plan einweihen sollte. Zwar wusste der junge Mann schon von dem, was heute stattfinden sollte, mehr jedoch auch nicht. Bisher hatten sie, insbesondere James, immer von den besonderen Talenten Dannys profitiert und vielleicht würde es auch dieses Mal so sein. Aus genau diesem Grund grübelte er darüber nach ihm zu sagen, was die Einzelheiten ihres heutigen Planes waren. Abermals schaute Talley zu dem Fahrer und erntete von ihm nichts als Nichtachtung. Er konnte seinen Zorn verstehen. Aber vielleicht würde er auch seine Tat mit mehr Vertrauen belohnen. James beschloss seine Entscheidung zu verschieben, bis er gefrühstückt hatte.
„Sie wollten mich sprechen, Sir?“ fragte Edward Jellico, nachdem er das Büro des Präsidenten betreten hatte. Es hatte etwas gedauert, bis er sich von der Arbeit hatte freimachen können, doch der Präsident würde hierfür Verständnis haben. Immerhin waren es nervenaufreibende Zeiten für alle. Diesmal war das Staatsoberhaupt nicht wie so oft in seine Akten vertieft gewesen, sondern hatte gedankenverloren die Wand angestarrt. Was wohl dem wichtigsten Mann des Quadranten wohl durch den Kopf ging?
„Ja, Mr. Jellico“, entgegnete der Präsident und bedeutete dem Gast näher zu kommen.
Der Umstand, dass er ihm keinen Platz anbot, schien Bände über seinen Gemütszustand zu sprechen.
„Wie kann ich ihnen helfen, Sir?“
Normalerweise war der Präsident ein Mann der sorgsam bedachten Worte, des Umschreibens und vorsichtig Herantasten. Eine Eigenschaft, die ihm schon mehr als einmal in interstellaren Verhandlungen geholfen hatte. Doch dieses Mal verzichtete er auf solche Spielereien. Stattdessen entschied er sich direkt zu werden. Es fehlte einfach die Zeit.
„Sie haben mir doch zu Beginn dieses furchtbaren Tages Captain Lewinski als den Mann empfohlen, der am Geeignetsten ist diese Krise zu lösen.“
„Ja, dies habe ich, Mr. President“, gab der Justizminister ohne zu zögern vor. Seltsam, er hatte sich wohl niemals in seinem Leben vorgestellt mal eine Lanze für seinen Erzgegner zu brechen. „Glauben sie mir, Mr. President, wenn einer diesen Fall aufklären kann, dann die Crew der Monitor!“ Dies waren seine Worte zu Beginn der Krise gewesen. „Eigentlich bin ich immer noch der Ansicht, wenn ich ehrlich bin.“
Nun erhob sich der Präsident, trat auf seinen Gesprächspartner zu und in seinem Gesichtsausdruck spiegelte sich deutlich der Zorn wieder, der in ihm brodelte. Er fühlte sich dermaßen enttäuscht und verraten, dass er kaum in der Lage war dies trotz seiner sonst so eloquenten Art in Gewohnheit zu fassen.
„Und wenn dem so ist, wieso verrät mich John Lewinski dann?“
„Wie bitte?“
Jellico konnte nicht glauben, was er da eben gehört hatte. Der sonst so souveräne und pflichttreue John Lewinski soll eine Anweisung des Präsidenten missachtet haben?
„Captain Lewinski verweigert den Befehl seinen Bruder herauszugeben. Vielleicht, aber nur vielleicht wäre ich in der Lage gewesen seinen widerrechtlichen Angriff auf das Gefängnis zu vergessen, doch nun hat er sich offensichtlich gegen mich gestellt. Ein Mann, den sie mir explizit für diese Mission empfohlen haben.“
Nur mit Mühe konnte Edward Jellico verhindern, dass seine Kinnlade nach unten klappte.
Mit dieser Wendung der Ereignisse hatte er ganz und gar nicht gerechnet. Normalerweise war er doch der Mann für illegale Aktionen gewesen und nun schien ihm der Kommandant der Monitor diesen Rang abzulaufen.
„Mr. President… ich weiß nicht, was ich sagen soll“, meinte Jellico und sprach damit die Wahrheit.
„Doch, dies können sie. Zum Beispiel, ob Captain Lewinski zur Sektion 31 gehört!“
Hatte der Präsident diese Worte etwa ernst gemeint? Edward Jellico blickte seinen Vorgesetzten ungläubig an und musste erst einmal die Bedeutung der eben geäußerten Worte verstehen.
„Wie kommen sie darauf?“
„Sie sind der Experten für Angelegenheiten, die Sektion 31 betreffen. Kann dieser ganze geplante Anschlag nicht doch eine Aktion der Untergrundorganisation sein, als Rache für unsere Aktionen zur Zerschlagung der Gruppe?“ fragte der Präsident und erwartete eine ehrliche Antwort.
Zu gerne hätte sich Edward Jellico als Chef der Sektion 31 eine solch gewaltige Tat selbst auf die Fahnen geschrieben, doch dieses Mal war er wirklich nicht dran beteiligt.
„Möglich wäre es“, log der ehemalige Admiral, „aber dies alles passt nicht zum Schema der Sektion 31. Und Captain Lewinski könnte niemals mit dieser Gruppe zusammenarbeiten.“
Der Präsident setzte zu einer Erwiderung an, kam jedoch nicht mehr dazu, denn Commander Kranick betrat ungefragt sein Büro und erklärte:
„Sir, ich habe von Admiral LaToya die benötigten Codes bekommen und umgehend das nächste Sternenflottenschiff in Kenntnis gesetzt. Mit ihrer Erlaubnis…“
„Beginnen sie. Sofort!“ befahl der Staatschef und setzte sich wieder an seinen Schreibtisch. Das Gespräch mit seinem Minister schien von einem Moment auf den anderen für ihn gestorben zu sein.
Jozarnay hatte sich geirrt, aber in diesem Fall war es nicht allzu schlimm gewesen. Es hatte sich bei seiner Fluchtmöglichkeit nicht um eine Wartungsöffnung, sondern um den Zugang zu einem altmodischen Belüftungssystem gehandelt. Durch die engen Röhren des Systems krabbelte nun der Antosianer und der Schweiß rannte ihm über die Stirn. Nicht nur war es äußerst anstrengend sich auf diese Art und Weise fortzubewegen, auch mussten sich die Wachen sehr wohl darüber bewusst sein, wo sich der Ausbrecher gerade befand. Sicherlich waren sie in Rage darüber, dass er ihren Kollegen getötet hatte und sinnierten nach Rache. Zwar wollte Edward Jellico den Gefangenen sicher lebend haben, jedoch war sich der ehemalige Chief alles andere als sicher, ob sich die Männer noch an diesen Befehl halten würden. So lautlos wie möglich versuchte sich Woil durch die Röhre zu bewegen.
Was er jedoch ebenso wenig bedacht hatte, war die Baufälligkeit des Gebäudes.
Das Lüftungssystem an sich war nicht nur veraltet, sondern auch der gesamte Bau und so war es nur eine Frage der Zeit, bis das Metall nicht mehr das Gewicht des Antosianers tragen konnte. Mit einem ohrenbetäubenden Krachen barst das Material unter dem ehemaligen Chief und er sauste in die Tiefe, mitten in einen anderen Raum hinein. Zu dumm, dass er sich hier nicht allein befand.
Geräuschvoll landete Woil auf einem weiteren Wachmann, der Unklugerweise genau unter der gebrochenen Röhre gestanden hatte. Das immense Gewicht des Materials, gepaart mit dem Ausbrecher, schlug den Wachmann K.o. und bot Jozarnay genau die entscheidenden Sekunden der Verwirrung, um sich neu zu orientieren. Das Schicksal hatte ihn in einen Durchgang katapultiert, in dem sich noch mehr Wachen befanden und die ihn verdutzt anblickten. Seit geraumer Zeit hatten sie sich auf der Suche nach dem Ausbrecher befunden, jetzt war er direkt vor ihrer Nase erschienen. Woil nutzte die Gunst der Sekunde, holte seinen Phaser hervor und erschoss zwei Wachmänner. Die anderen drei traf er zwar nicht, sein gezieltes Dauerfeuer zwang sie jedoch in Deckung und gab ihm ebenfalls die Möglichkeit sich, über den Gang robbend, in Sicherheit zu bringen. Hektik brach bei den Wachen aus, sie schrieen sich durch den Gang etwas zu oder brüllten Jozarnay an, doch durch ihr Stimmenwirrwarr konnte er eigentlich nicht raushören, was sie von ihm wollten. Die Zeit des Schleichens und des Paktierens schien vorbei zu sein, nun galt es zur Konfrontation überzugehen. Vorsichtig lugte der Antosianer um die Ecke und nur knapp fauchte ein Phaserstrahl an ihm vorbei.
Als Antwort gab er zwei ungezielte Schüsse auf die Schützen ab und zwang sich wieder in Deckung.
„Du kannst nicht zu lange hier bleiben!“
Stellas Worte entsprachen den Tatsachen. Mehr musste sie auch nicht sagen, denn Woil verstand die Brenzligkeit seiner Situation.
„In wenigen Sekunden werden sie mich umzingeln, “ murmelte der ehemalige Chief, „und mich dann endgültig kriegen. Aber ich werde mich nicht noch einmal einsperren lassen!“
„Deine Konsequenz?“ fragte seine Begleiterin lächelnd und kannte doch schon die Antwort. Sie wollte sie jedoch aus seinem Munde hören.
„Das Weglaufen ist vorbei. Es gilt: jetzt oder nie!“
Es hatte sich genau um die Worte gehandelt, die sie von ihrem Liebsten hatte hören wollen. Endlich war die Zeit des Paktierens und davonlaufen vorbei, nun zog er die Konfrontation der Ablenkung vor. Ohne eine weitere Sekunde zu verlieren, stürmte Jozarnay aus seiner Deckung hervor und rannte auf die Wachen, welche ihm den weiteren Weg versperrten, zu. Ohne Unterbrechung feuerte er auf seine Gegenüber und rannte weiter. Es ging ihm weniger darum etwas zu treffen, als seine Gegner vielmehr selbst am gezielten Schuss zu hindern. Angesichts dieser etwas unkonventionellen Taktik waren die Wachen Jellicos selbst so überrascht, dass ein weiterer Sicherheitsmann getroffen zu Boden ging. Die anderen versuchten zwar den Antosianer zu treffen, doch ihre scheinbar gezielten Schüsse rauschten an dem Ausbrecher vorbei. Es schien fast so, als hielt eine göttliche Macht seine schützende Hand über den ehemaligen Chefingenieur der Monitor. Fast schon überrannte er die sich ihm entgegenstellenden Wachen, trat sie oder schoss sie nieder. Jozarnay war fast in Rage. Seine ganze Umgebung um ihn herum verlor ihre Konturen, wurde zu einem schlierigen Etwas.
Er hatte nur noch den Ausgang aus diesem Gefängnis vor Augen, mehr nicht. Entweder schaffte er es oder starb bei dem Versuch. Aber er würde sich ganz gewiss nicht noch einmal einfangen lassen!
Angesichts dessen, was in den letzten zwei Stunden geschehen war hatte sich Danny dazu entschlossen alleine zu frühstücken. Doch selbst das klägliche Essen, welches er auf seinem Zimmertisch aufgedeckt hatte, rührte er so gut wie gar nicht an. Stumm saß er auf seinem Stuhl und dachte immer noch nach. James hatte seinem Wunsch nach Ruhe entsprochen und sich mit seinen engsten Mitarbeitern an den Frühstückstisch zu setzen.
Es klopfte an seiner Tür und für einen kurzen Moment überlegte der junge Mann, ob er den Besucher hineinrufen sollte. Dann jedoch besann er sich seiner Manieren und ließ die Person eintreten. Es brachte einfach nichts hier zu sitzen und immer wieder über die vergangenen Ereignisse nachzudenken. Natürlich musste er die Tötung Nelsons irgendwann aufarbeiten, doch derzeit war keine Gelegenheit dazu. Um seine Deckung aufrecht zu erhalten und seinen Auftrag weiter ausführen zu können musste er hochkonzentriert bleiben. Einmal hätte er sich schon fast verraten, dies durfte nicht noch einmal passieren.
Zu seiner Überraschung betrat Janine Talley sein Zimmer und schloss leise die Tür hinter sich.
„Hi“, meinte die junge Frau zurückhaltend und stand in seinem Raum, mit verschränkten Armen und schien auf seine Reaktion zu warten. Danny jedoch wandte sich wieder von ihr ab, widmete sich wieder seinem Frühstück, von dem er nur einen kleinen Bissen nahm.
„Bist du immer noch so schweigsam?“
Die Frage Janines hätte nicht unpassender sein können. Verstand sie etwa nicht, was die ganze Zeit über im Kopf ihres Gefährten umherging? Oder war sie inzwischen genauso geworden wie ihr Vater, gefühlskalt und nur ihrer großen Sache verschrieben?
Instinktiv fragte sich der Lieutenant, wie ehrlich seine Liebe zu dieser Frau war. In den letzten drei Monaten hatte er eine Beziehung zu Janine aufgebaut, die weit über die Tarnung seiner Infiltration hinausging. Er hatte Gefühle für sie entwickelt, die erwidert wurden. Und dennoch fragte sich Bird, ob Janine nicht nur ein Ersatz für Elisabeth war. Natürlich hatte er inzwischen mit diesem Kapitel seines Lebens abgeschlossen. Doch die Chefärztin der Monitor war die Frau gewesen, die er geliebt und niemals hatte kriegen können. Waren die Motive seiner Liebe zu Janine aufrecht? Derzeit konnte Bird scheinbar keine seiner Fragen mit Gewissheit beantworten.
„Was erwartest du von mir?“ entgegnete Danny, ohne von seinem Teller aufzusehen. „Ich habe vor nicht einmal zwei Stunden einem anderen Menschen das Leben genommen und scheinbar interessiert sich hier keiner dafür. Ist euch das Leben eines Mannes, den ihr sogar gekannt habt, so wenig wert?“
Angesichts dieser Worte blickte auch Janine zu Boden, überlegte sich ihre nächsten Worte genau. Natürlich war dies eine schwere Zeit für Danny, doch er musste lernen damit fertig zu werden. Andernfalls würde er niemals eine Zukunft innerhalb der Befreiungsarmee haben.
Vorsichtig setzte sie sich auf sein Bett und legte ihre Hände in den Schoß.
„Auch ich habe Josh lange gekannt… er hat mich aufwachsen sehen und sein Tod ist für mich ebenfalls eine große Belastung. Aber er war ein Verräter…“
„Diese Wortwahl kenne ich doch irgendwoher“, unterbrach der Mann sie und blickte sie eindringlich an. „Genau die Worte, die dein Vater vor wenigen Minuten an mich gerichtet hatte. Man merkt wirklich, dass ihr zum selben Schlag gehört.“
Danny bewegte sich auf einem gefährlichen Pfad, dies wurde ihm einmal mehr deutlich. Wenn er sich noch mehr in Rage redete, so lief er Gefahr sich selbst zu verraten. Eigentlich wäre es klüger gewesen nun zu schweigen, doch aus irgendeinem Grund konnte er dies nicht.
„Du meinst es nicht so, dies ist nur der Frust, der aus dir spricht“, entgegnete Janine Talley, doch deutlich zeigte sich in ihren Augen der Schmerz.
„Woher willst du das wissen? Vielleicht war ich ja zu blauäugig, um die Wahrheit zu sehen. Ich dachte ich hätte hier eine Zukunft. Eure Ziele schienen mir die richtigen zu sein, aber Mord…“
„Du widersprichst dir selbst, Danny! Auf der einen Seite hilfst du uns einen biologischen Virus auf der Erde freisetzen zu wollen, aber gleichzeitig willst du einen einzelnen Menschen nicht töten?“
Nun war es an Danny wieder zu schweigen und über diese Worte nachzudenken. Abermals lief er Gefahr sich zu verraten. Er musste an dieser Stelle das Gespräch abbrechen, denn ansonsten würde er noch großes Unheil über sich bringen.
„Ich bin einfach nur geschafft“, murmelte Danny und würgte das Thema so ab.
Beruhigenderweise fühlte er die Hand Janines auf seiner Schulter. Eine einfache Geste, die ihm Trost und Geborgenheit spendete.
„Ich liebe dich, Danny“ flüsterte die Tochter des Anführers und Bird erwiderte ihre Liebesbekundung.
„Ich liebe dich auch. Möchtest du noch etwas?“
Kurz dachte Janine darüber nach, ob nun der richtige Zeitpunkt hierfür war. Seit einiger Zeit brannte ihr diese Sache auf der Seele, doch scheinbar gab es einfach nicht die richtige Gelegenheit, um dieses Thema anzusprechen. Also beschloss sie es zu verschieben.
„Nein, es ist nichts. Bitte lass dich nicht so hängen. Wir sind kurz vor unserem Ziel!“
Mit diesen abschließenden Worten verließ Janine wieder das Zimmer ihres Liebsten und seufzte. Abermals hatte sie nicht geschafft ihm die Wahrheit zu sagen. Vielleicht bot sich ja am Ende dieses langen Tages die Gelegenheit dazu.
Auf einem gänzlich anderen Planeten mit dem Namen Rigel war es wie so oft eine kalte Nacht. Der Wind fauchte durch die Straßen der grauen Industriestadt und nur wenige Bewohner waren unterwegs, um noch einige letzte Besorgungen zu machen.
Die Haustür der Wohnung von Birgit Price öffnete sich und der auf die Straße tretende Mann schlug instinktiv den Kragen seines braunen Mantels hoch, um sich gegen den pfeifenden Wind zu schützen. Der Besuch Arsani Paruls bei seiner alten Liebe war gänzlich anders verlaufen, als er es sich vorgestellt hatte. Eigentlich hatte er nur reden wollen. So vieles gab es zu klären, insbesondere auf ihren gemeinsamen Sohn Matthew. Doch nun war es zu weitaus mehr gekommen. Seltsam, in den letzten Monaten war das Leben des ehemaligen Sonderbotschafters der Föderation komplett aus der Bahn geworfen worden und nichts lief mehr so wie früher. Sein Leben war überraschender geworden, verlief in nicht zu erwartenden Wendungen.
„Was die Zukunft wohl so bringen mag…“ murmelte der Betazoid gedankenverloren und begann die lange Straße entlang zu gehen, die ihn schließlich zum Raumhafen bringen sollte. Sein Besuch auf Rigel war vorbei, es war alles gesagt und getan worden, was er sich vorgenommen hatte… und sogar noch mehr. Es war an der Zeit sein Leben wieder zu ordnen.
James blieb nicht allzu viel Gelegenheit, um sein prachtvolles Frühstück zu genießen. Schon nach wenigen Minuten trat einer seiner Bediensteten auf ihn zu und berichtete ihn von einem eingehenden Telefonat. Nur kurz rollte der Anführer der Föderalen Befreiungsarmee mit den Augen, dann besann er sich der Wichtigkeit des Anrufers und entschuldigte sich bei den Tischgenossen. Schnell begab er sich in seinen privaten Raum und aktivierte den Kommunikationsschirm. Wen er da jedoch erkannte überraschte ihn.
„Sie schon wieder?“ fragte James überrascht. „Bisher haben sie noch nie zweimal an einem Tag angerufen… geschweige denn zweimal in einem Monat.“
„Heute ist ein wichtiger Tag. Da steht es mir wohl zu mich nach den Fortschritten der Operation zu erkundigen, “ entgegnete die Stimme am anderen Ende der Leitung.
„Wir sind immer noch da, wo wir vor zwei Stunden auch waren“, erklärte James Talley. Er hasste es, sich vor dieser Person rechtfertigen zu müssen. „Der Plan läuft immer noch und die Föderation ist uns immer noch nicht auf die Spur gekommen. Vertrauen sie mir doch einfach!“
„Hat nicht eine ihrer historischen Persönlichkeiten nicht gesagt Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser?“
„Gerade aus ihrem Mund eine menschliche Redewendung zu hören ist für mich mehr als überraschend“, war die zynische Erwiderung James´. Am liebsten würde er sofort das Gespräch beenden. Doch diese Person hatte sich maßgeblich an der Finanzierung und Planung der Operation beteiligt und durfte daher nicht ausgeschlossen werden. Außerdem war sie mächtiger als James es war und hätte jederzeit sie alle auffliegen lassen können. Aus genau diesen Gründen hielt es Talley für angebrachter seine Gedanken nicht laut auszusprechen.
„Nur weil ich ihre Spezies verabscheue gibt es nicht einzelne Vertreter ihrer Art, die Bewunderung verdient haben. Nun gut, ich werde ja weiterhin von ihnen informiert werden. Wir hören voneinander.“
Mit diesen Worten beendete die Person die Kommunikationsverbindung und ließ James mit seinen Gedanken allein. Hoffentlich war dies der letzte Anruf für heute, denn bei dem Gedanken an ihren Geldgeber schüttelte sich bei James alles!
Schweiß rannte über seinen Körper, doch dieses Mal fühlte sich Jozarnay lebendig. Rührte die Erschöpfung ja nicht vom dem Drogenentzug, sondern von den Anstrengungen seiner Flucht. Dennoch, auf eine bizarre Art und Weise, genoss er seine Flucht. Wachsam schlich Woil durch die Gänge, horchte ab und an, ob sich Wachen näherten und rannte dann wieder ein Stück.
„Es ist schon seltsam“, fand Jozarnay und lugte mit dem Phaser um eine weitere Ecke.
„Was meinst du?“ fragte Stella, die wie immer an seiner Seite war. Es wirkte bizarr, dass trotz des Chaos sie scheinbar ungerührt hier war und sich mit ihm so ungezwungen unterhielt. Hatte sie denn keine Angst um ihr eigenes Leben?
„Ich habe bisher auf dieser Flucht mehrere Menschen getötet. Aber aus irgendeinem Grund… berührt es mich nicht.“
Die Worte des ehemaligen Chiefs drückten eine Verwirrung aus, die ihn schon seit einiger Zeit plagte.
„Sie haben dir Leid angetan und erhielten das, was sie verdienten.“
„Nein… das ist es nicht.“
Aus irgendeinem unerfindlichen Grund war er nicht in der Lage seine Gefühle in Worte zu fassen. Noch vor kurzem hatte er seinen Gefangenen getötet und schon jetzt tangierte es ihn nicht mehr. Waren seine Gefühle etwa so erkaltet?
Und schließlich war es soweit. Fast schon hatte er seinen Glauben daran verloren, es nicht mehr für möglich gehalten, schlussendlich hatte er es endlich geschafft: er hatte einen Ausgang gefunden. Jetzt endlich konnte er aus den Fängen Edward Jellicos entfliehen und Rache ausüben. Ein letztes Mal vergewisserte sich Jozarnay allein zu sein, dann öffnete er eine Zugangstür, die, nach Aussage Stellas, ihn nach draußen bringen sollte.
Als er den schweren Zugang geöffnet hatte schlug ihm ein stürmischer Wind entgegen. Schnee rieselte herab und ließ Woil für einen kurzen Moment den Atem stocken. Auf der Erde war es kein Winter gewesen, als er das letzte Mal das Tageslicht gesehen hatte. Hatte er sich etwa schon so lange in Gefangenschaft von Sektion 31 befunden? Vorsichtig stampfte der Antosianer nach draußen, hielt sich die Hand vor das Gesicht, um es vor Kälte zu schützen. Scheinbar hatte sich das Gefängnis unterirdisch befunden, denn mehr als einmal war er Treppen hinauf gerannt und hinter ihm war kein Gebäude zu sehen. Es war dunkel, scheinbar Nacht und die Umgebung mehr als unwirtlich. Woil musste die Augen zusammenzukneifen, um die Konturen am Horizont zu erkennen. Es gab Gebäude, diese waren jedoch eingefallen, zerstört und somit nicht mehr als Ruinen.
„Wie kann das sein?“ rief Woil gegen den Wind an, bekam jedoch keine Antwort. Plötzlich war Stella nicht mehr da, gab ihm keine neuen Antworten. All dies wirkte so seltsam…
Plötzlich sah er eine andere Person, eine Gestalt im Sturm. Woil trat näher auf sie zu und erkannte ein kleines Mädchen, welches durch die Nach irrte. Vorsichtig näherte er sich ihr, hoffte vielleicht durch sie etwas Hilfe bekommen zu können. Dann jedoch erstarrte er, als er in ihr Gesicht blickte. Ihr talarianisches Gesicht!
Und auf einmal fügte sich alles zusammen. Die Ruinen, der Sturm, das talarianische Mädchen. Sich des grauenvollen Schicksals bewusst werdend, schrie Woil frustriert in die Dunkelheit hinaus:
die ganze Zeit über hatte er sich auf Talar befunden!
Für einen kurzen Moment hatte sich die Chance geboten mal mit seinem Bruder zu sprechen. Martin trat auf den Captain zu und raunte ein Wort, welches er niemals erwartet hatte über die Lippen zu bringen:
„Danke.“
Gedankenverloren, so als ob er abwesend wäre, blickte John auf und konzentrierte seine Aufmerksamkeit auf seinen Bruder.
„Wofür?“
„Du hast viel für mich riskiert“, erklärte der verurteilte Waffenhändler. „Erst die Befreiung aus dem Gefängnis, dann stellst du dich gegen die Befehle des Präsidenten… du wirfst gerade deine Karriere weg. Für mich.“
Angesichts dieser Worte erhob sich John aus dem Stuhl, blickte seinen Bruder fest an und war für einen Moment ratlos, was er nun sagen sollte. Es schien sich hier um eine verkehrte Welt zu handeln. Nun war es Martin, der ihm dankbar war und er konnte diesen Zuspruch nicht ertragen.
„Ich tue dies für die Sicherheit der Föderation.“
„Sicherlich machst du das. Aber sei dir sicher, dass ich dir dankbar bin. Ob du es glauben möchtest oder nicht, wir haben doch mehr Gemeinsamkeiten als du glaubst. Heute hast du deine ersten gesetzeswidrigen Taten vollbracht.“
Instinktiv ballte John seine Fäuste, eine angesichts den Umständen völlig sinnlose Geste, die jedoch seinen Gemütszustand deutlich beschrieb.
„Vielleicht mag es lange gedauert haben“, meinte Captain Lewinski, „aber ich habe eingesehen, dass wir wohl nicht viele Gemeinsamkeiten haben. Wir mögen Brüder sein, aber unsere Ansichten sind gänzlich unterschiedlich.“
Martin wollte noch etwas erwidern, kam jedoch nicht dazu. Denn plötzlich erhellte sich die Brückenbeleuchtung und hektische Betriebsamkeit brach aus. Fähnrich Kensington bestätigte die Vermutung:
„Die Tarnvorrichtung ist soeben ausgefallen!“
„Was?“ fragte Lewinski und begab sich umgehend zur taktischen Station. War dies etwa die Antwort des Präsidenten? Mit einer so schnellen Reaktion hatte er beileibe nicht gerechnet.
„Tarnen sie uns umgehend wieder!“ befahl der Kommandant.
„Es geht nicht, Sir. Irgendwie sind unsere Kontrollen überschrieben worden.“
„Dies funktioniert nur mit den entsprechenden Codes des Oberkommandos“, meinte Price, der sich sofort an die Navigationskontrollen gesetzt hatte. Im Moment mussten sie wohl mit allem rechnen und genau dies trat auch ein.
„Ein Schiff dreht bei und geht auf Abfangkurs“, meldete Ardev und vergaß für den Moment die Sensorsuche der Erde. „Es ist die USS Community!“
Entsetzt blickte Price zu seinem Captain und dieser schaute ihn auch verwirrt an. Scheinbar war ausgerechnet dieses Schiff das nahste zu ihnen gewesen und sollte sie nun abfangen.
Und wie erwartet erschien das Gesicht der Kommandantin der Community auf dem Wandschirm der Monitor. Seit Wochen und Monaten hatte sich Commander Price gewünscht seine Tochter und mit ihr seine Imzadi wieder zu sehen, doch dieses Mal waren die Umstände mehr als unglücklich.
„Hier spricht Captain Selina Kyle von der Community“, erklärte die Frau mit neutraler Stimme. Ihr lag alles daran die Situation nicht ausarten zu lassen. „Übergeben sie Martin Lewinski und bereiten sie sich darauf vor, dass wir an Bord kommen.“
Captain Kyle!“ begrüßte John Lewinski seine Gegenüber und stellte sich in die Mitte der Brücke. „Ich gratuliere ihnen zu ihrer Beförderung.“
„Danke, Captain. Aber ich denke kaum, dass dies der geeignete Zeitpunkt ist, um über meinen neuen Rang zu sprechen,“ erwiderte Kyle selbstsicher und für einen kurzen Moment fiel ihr Blick auf den an der Navigation sitzenden Matt Price. Mittels seiner empathischen Fähigkeiten konnte er deutlich fühlen, dass auch seiner Imzadi die Situation alles andere als gefiel. „Ich bin hier auf Befehl des Präsidenten und bitte sie inständig meinen Befehlen zu gehorchen.“
„Sind sie sich über die gegenwärtige Lage im Klaren?“
„Ja, ich bin vollständig informiert worden. Tatsächlich ist der Präsident uns über Audio zugeschaltet, er bekommt also alles mit.“
Verstehend nickte John und überlegte, wie er diese Information zu seinem Vorteil nutzen konnte. Jedoch fiel ihm keine probate Möglichkeit ein.
„Dann sollten sie meine Aktionen und meine Entscheidung nachvollziehen können“, meinte John.
„Es ist nicht an mir etwas zu bewerten, sondern die Befehle des gewählten Führers der Föderation zu befolgen und diese sind unmissverständlich. Bitte, Captain Lewinski, machen sie die Sache nicht noch schwerer, als sie ist.“
Gebannt blickten alle auf der Brücke zu ihrem Kommandanten und fragten sich, was er nun sagen würde. Derzeit schien alles möglich zu sein.
„Ist dies überhaupt möglich?“ fragte Lewinski rein rhetorisch und fragte sich, wie lange wohl noch die Sensorauswertung dauern würde. Natürlich tat Ardev alles Mögliche, um schnellstmöglich an Ergebnisse zukommen, doch ihnen lief die Zeit davon. „Wir werden ihre Anweisungen nicht befolgen.“
„Ist dies ihr letztes Wort?“ fragte Captain Kyle, der deutlich das Unbehagen anzusehen
war. „Bitte tun sie uns dies nicht an und beenden sie die Krise auf der Stelle. Ansonsten müssen wir Gewalt zur Durchsetzung der präsidialen Befehle anwenden.“
Kurz drehte sich John auf der Brücke herum, wollte in die Gesichter der Offiziere blicken, die so vieles bisher mitgemacht hatten. Würden sie auch jetzt noch bereit sein ihm zu folgen?
So vieles hatte er bisher von ihnen abverlangt. Hoffentlich würden sie ihm auch jetzt folgen. Ausgerechnet bei seinem Bruder blieb sein Blick als letztes hängen. Er liebte ihn, auch wenn ihre gemeinsame Vergangenheit mehr als problematisch war.
Schließlich traf John seine Entscheidung. Er zog die Sache nun durch.
„Roter Alarm! Alle Mann auf der Krankenstation!“
Eingespielte Hektik begann auf der Monitor, als die Alarmsirenen losheulten und überall an Bord die roten Leuchten aufglühten. Matrosen und Offiziere eilten auf ihre Plätze, um das Schiff auf den Kampf vorzubereiten.
Verdutzt blickten sich Jellico und der Präsident an, die auf der Erde das ganz Gespräch mithörten. Die Situation entwickelte sich nicht so, wie sie es erwartet hatten.
„Das kann nicht ihr Ernst sein“, entgegnete Selina Kyle, nachdem sie sich wieder von der Überraschung erholt hatte. Noch immer befand sich ihr Schiff auf Abfangkurs. „Captain Lewinski, sie lassen die Situation eskalieren.“
„Nein, sie sind es, die die Eskalationsstufen nach oben treiben. Drehen sie mit der Community ab und lassen sie mich meine Arbeit machen, um die Erde zu retten.“
„Wenn sie bereit wären noch einmal mit dem Präsidenten zu reden…“
„Verdammt, wir haben keine Zeit mehr, Selina!“ brüllte John und machte seine unnachgiebige Haltung einmal mehr deutlich. „In diesem Moment, wo wir miteinander sprechen planen Terroristen einen verheerenden Anschlag auf die Wiege der Menschheit, die alles Leben beenden könnte. Denken sie nach!“
Noch einmal ließ Captain Kyle ihren Blick über die Brückencrew der Monitor schweifen. Wegen Matt kannte sie alle an Bord dieses Schiffes gut. Sie waren im mindesten Bekannte, einige wenige dort würde sie sogar als Freunde bezeichnen. Bei dieser ganzen Sache konnte sie nicht aufhören an Matthew zu denken. Den einzigen Mann, den sie immer lieben würde und der der Vater ihrer Tochter war.
„Übergeben sie ihr Schiff, Captain!“ befahl Kyle ein letztes Mal und rechnete nicht damit, dass man nun ihrer Aufforderung folgen würde.
„Fähnrich Kensington, feuern sie einen Quantentorpedo vor den Bug der Community!“
Scheinbar hatte sich die junge Frau schon auf eine solche Anordnung vorbereitet, denn schon im nächsten Moment verließ ein Torpedo die Startrampen des Schiffes und detonierte kurz vor dem Rumpf der Community.
„Die USS Community dreht nicht bei und wird in 30 Sekunden uns erreicht haben“, meldete Lieutenant Ardev und deutlich zeigten sich auf seiner Stirn Schweißperlen.
Gedanken rasten durch Johns Kopf. Nach außen hin wirkte er völlig selbstsicher, aber derzeit fragte er sich, ob er das richtige tat. Leider war es nun zu spät umzudrehen.
„Erfassen sie Captain Kyle Schiff mit den Waffen und bereiten sie alle eine volle Salve vor!“
Dieser Befehl war zuviel für den ersten Offizier der Monitor. Entsetzt erhob er sich von seinem Platz, blickte kurz zu Selina auf dem Wandschirm und dann zu seinem Captain.
„Das kannst du nicht tun, Skipper!“
„Captain Kyle lässt mir keine Wahl und ich bin nicht bereit aufzugeben. Wir befinden uns kurz vor dem Ziel, “ erklärte John mit sichererer Stimme, als er angenommen hatte.
„Aber Yasmin ist dort an Bord!“ schrie Matt und erstmals konnte man am heutigen Tage Panik in seinen Augen erkennen.
Natürlich wusste John dies und es tat ihm leid. Die ganze Ereigniskette schien zu eskalieren und eigentlich hatte er dies nicht vorgehabt. Scheinbar kontrollierten die Ereignisse ihn und nicht umgekehrt.
„Waffen geladen und Ziel erfasst“, meldete Fähnrich Kensington und wartete nur auf den Einsatzbefehl. Im Gegensatz zum ersten Offiziere würde sie nicht zögern den Befehl auszuführen.
„Setz dich wieder an deinen Posten“, wies John seinen ersten Offizier und Freund an, doch dieser Machte keine Anstalten den Befehl auszuführen.
„John… bitte!“ flehte der Halbbetazoid, doch er kam der Aufforderung nach. Mit zitternden Händen bediente er wieder die Kontrollen.
„Community in Waffenreichweite!“
Ein letztes Mal blickte John die Personen an, die in diesem Moment wichtig waren. Ardev und seine Frau, die sich an Bord der Monitor kennen gelernt und geheiratet hatten. Fähnrich Kensington, die seit Monaten Lieutenant Bird vertrat und eine glänzende Karriere vor sich hatte. Lieutenant Sanchez, der Nachfolger von Chief Woil als Chefingenieur. Matt Price, der eine Tochter hatte und eine gemeinsame Zukunft mit Dr. Frasier plante. Und sein Bruder, um den es bei dieser ganzen Sache ging. Würde er sie nun alle opfern, um ein höheres Ziel zu erreichen? Ein allerletztes Mal versuchte John an seine Gegenüber zu appellieren.
„Captain Kyle, denken sie nach. Milliarden von Leben stehen auf dem Spiel!“
Doch statt eine Antwort von sich zu geben ließ auch die Frau auf ihrem Schiff die Gefechtsbereitschaft herstellen. Zwar befahl sie ein modernes Schiff der Prometheus-Klasse, doch würde sie überhaupt eine realistische Chance gegen die Monitor haben?
Deprimiert und dennoch sicher das richtige zu tun setzte sich Captain Lewinski auf seinen Kommandantenstuhl. Es begann:
„Feuern sie aus allen Batterien auf die Antriebe der Community!“
I've got a bad liver and a broken heart
Theres no salvation in the comfort of you
I finally realized your tearing me apart
[Chorus:]
So help me, save me, tell me that the end is near
Help me, save me, tell me that the end is near
I am done with you
You made my life completely miserable
You drove me to the edge, you've caused me all this pain
But I've always loved you cause your oh so special
I'm broken and I'm alone and I can't maintain
[Chorus]
Done with you (done with you)
I am done with you (done with you)
I am done with you (done with you)
I am done with you (done with you, I'm done with you)
I count the days that we have spent apart
I've got a bad liver and a broken heart
Help me, save me,
Tell me that the end is near
Help me, save me,
Tell me that the end is here
I am done with you
Because you and me are through
You couldn't help me
You couldn't save me
Now I know the end is here
I am done with you
Schuld
based upon "STAR TREK" created by GENE RODDENBERRY
produced for TREKNews NETWORK
created by NADIR ATTAR
executive producers NADIR ATTAR & CHRISTIAN GAUS
co-executice producer SEBASTIAN OSTSIEKER
producer SEBASTIAN HUNDT
lektor OLIVER DÖRING
staff writers THOMAS RAKEBRAND & JÖRG GRAMPP and OLIVER-DANIEL KRONBERGER
written by NADIR ATTAR & CHRISTIAN GAUS
TM & Copyright © 2005 by TREKNews Network. All Rights Reserved.
"STAR TREK" is a registered trademark and related marks are trademarks of PARAMOUNT PICTURES
This is a FanFiction-Story for fans. We do not get money for our work!
Quelle: treknews.de





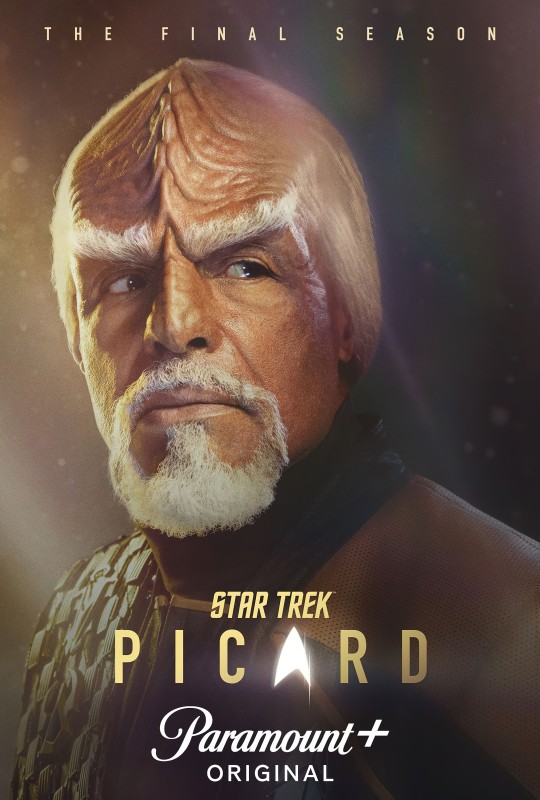



Empfohlene Kommentare
Keine Kommentare vorhanden